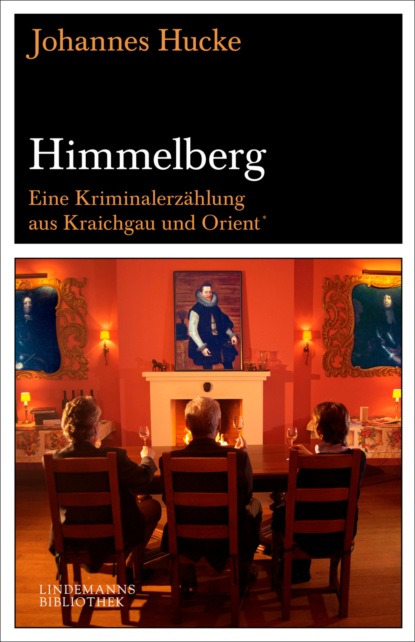Verbunden mit dem Dank für oftmals erwiesene Gastfreundschaft und Unterstützung, widme ich „Himmelberg“ der Familie derer zu Hoensbroech.
Johannes Hucke
Eine Kriminalerzählung aus Kraichgau und Orient
Johannes Hucke, geboren 1966, hat mit seinem „Kraichgauer Weinlesebuch“ (2007, 2. Auflage 2009) die Landschaft zwischen Schwarz- und Odenwald vinologisch erschlossen. 2010 folgte der Kraichgau-Krimi „Rotstich“ (2. Auflage 2010), 2011 ein Krimi zu Peter und Paul, „Die Brettener Methode“, der Weingutskrimi „Frühlingsfahrt“ sowie die Kriminalerzählung rund ums Weltkulturerbe Kloster Maulbronn „Aqua Asini. Eselswasser“. Als Theaterautor ist er erfolgreich, u. a. mit dem Wein-Theaterstück „Kellersequenz“. Weitere Veröffentlichungen im Info Verlag: „Bergstraße Weinlesebuch“ (2. Auflage 2012), „Südpfalz Weinlesebuch“ (2009), außerdem mit Holger Nicklas „Strafraum“, ein KSC-Krimi (2. Auflage 2010) und „Totland“, KSC-Krimi Nr. 2 (2010), die Unternehmensgeschichte „Das Beste aber ist das Wasser“ (2010), „Frankfurter Stückchen. Ein Märchen aus der neuen Altstadt“ (2010), „Neckarstadt Western. Der durchgeknallte Mannheim-Roman“ (2010), „Libellen greifen selten zu Labello“, Gedichte (2010), „Frühlingsfahrt“ (2011), „Aqua Asini“ (2012) und Mitherausgeber der Karlsruher Kindergedichte „Wo ich hingeh, geh ich hin“ (2011).
I.
Wenn die Klinge die Sonne sieht
Wisst ihr denn, auf wen die Teufel lauern
In der Wüste, zwischen Fels und Mauern?
Und wie sie den Augenblick erpassen,
Nach der Hölle sie entführend fassen?
(Goethe / Hafis)
Attaque Simulée
Ein sonderbarer Geruch steigt auf, als Rüdiger Reichsgraf und Marquis zu Hoensbroech (sprich: Hunsbruch) die Truhe öffnet, um den betagten Kavalleriedegen hervorzuholen. Nicht nur Moder und Mottenpulver sind die Urheber dieses Duftgemischs; gewiss, die Truhe stand lange auf dem Dachboden, wer mag zuletzt darin gestöbert haben? Aber es dominiert nicht der erwartete Muff abgetragener Kleidungsstücke, aus der Mode gekommener Vorhänge und Tischdecken, sondern etwas nicht mehr Greifbares, Fremdgewordenes, geradezu Abstraktes vernebelt dem Sucher für den Moment die Sinne: Es ist das Arom eines versunkenen Jahrhunderts, des neunzehnten, als alles noch anders war in Europa – gelegt zu den Akten scheinbar für immer, abgehakt, versiegelt ... und auf einmal wieder emporgeschreckt, ans Licht gezerrt, exhumiert. Unter schweren Samt- und Brokatdecken findet der Graf die Waffe; der Knauf verziert mit dem gekrönten Löwen, dem Familienwappen, die Scheide aus getriebenem Silber. Wie eben erst aus dem Verkehr gezogen, baumeln Kette und Ledergehänge an den Ösen. Es kommt dem Erben zu Bewusstsein, dass dieses handgeschmiedete Werkzeug vermutlich einst in den hölzernen, sargähnlichen Kasten platziert wurde, kurz nachdem Taten damit getan wurden – welche auch immer. Friedlich werden sie vermutlich nicht gewesen sein.
„Wenn die Klinge die Sonne sieht, soll sie Blut schmecken“, fällt Graf Hoensbroech jene bitterernste, oftmals missdeutete Spruchweisheit aus dem Japan der Samurai ein, die nicht Blutdurst predigt, sondern vor eilfertigem Missbrauch warnt.
Ohne Hast, doch zügig, senkt er den Truhendeckel, erhebt sich und trägt den Degen nach draußen. Auf dem Treppenabsatz streift er die Reitjacke über und knöpft sie zu. Vor dem Flurspiegel legt er den Gurt um; mürbe ist das Material geworden, hoffentlich hält es noch: Nicht auszudenken, wenn er die Attacke reitet, nach der Waffe greift, und es ist nichts mehr da, womit er angreifen könnte! Dass Heldenmut und Lächerlichkeit nahe beieinander liegen, gehört ebenfalls zu den altbekannten Überlieferungen.
Erstaunlich, wie gut die Handgriffe noch sitzen, nach so langer Zeit. Ob er das alles auch beim Reiten gut hinbekommt, wird sich zeigen. Nie wäre es dem Grafen in den Sinn gekommen, noch einmal auf solche der tiefsten Vergangenheit angehörenden Methoden zurückzugreifen. Doch die ungeheuerlichen Vorkommnisse auf seinem Weingut und in den Reblagen am Himmelberg verlangen nach ebenso drastischen Maßnahmen. Der Reichsgraf, als einziger seiner Familie befugt, den Titel des Marquis zu tragen, weiß sonst keinen Ausweg. Spätestens seit dem Anruf vor einer Stunde liegt klar vor ihm, was er zu tun hat. Man könnte sich ja nicht mehr ins Gesicht sehen, wenn man jetzt zögerte.
Im Geschwindschritt steigt er die Stufen ins Parterre herunter. Erwartungsgemäß wird er hier auf den ersten Widerstand treffen. Doch es sind nicht die unversehens ins Angelbachtal eingefallenen Feinde, die ihn hier aufhalten. Gräfin Maria steht in der Tür. Ihr Blick drückt Sorge und tiefe Missbilligung aus.
„Ich werde jetzt bestimmt nicht die Hände ringen und mich vors Pferd werfen.“
„Das verlangt auch keiner. Bleib lieber drin. Es ist frostig heute.“ Der Marquis eilt an seiner Frau vorbei nach draußen.
Einen letzten Versuch unternimmt die Gräfin, um die Eskalation zu vermeiden: „Ich frage mich nur, wozu die Polizei da ist!“
„Für Angelegenheiten von Staats wegen. So etwas macht man lieber selber.“
Gräfin Maria zu Hoensbroech bleibt zurück. Sie schüttelt den Kopf und fasst ihre Gedanken in einem einzigen Wort zusammen.
„Männer.“
Das Weingut des Reichsgrafen und Marquis zu Hoensbroech, vor gerade einmal einem halben Jahrhundert mit Sinn für die hellen Seiten der Tradition entgegen dem Zeitgeschmack in einer Talaue unweit des Eichtersheimer Wasserschlosses erbaut, verfügt auf der dem Hoftor abgewandten Seite über Stall und Scheune und eine kleine Pferdekoppel. Seit langem hat sich die Familie auf edle Schimmel spezialisiert, ein im Umkreis oftmals anekdotisch verarbeiteter Gegenstand. Das Lieblingspferd des Grafen, überrascht und erfreut durch den Besuch seines Herrn zu ungewohnter Stunde, streckt seinen Kopf über das Gatter.
„Ja, gleich“, ersucht er das hin und her tänzelnde Tier um Geduld und begibt sich ins Stallgebäude.
Wäre doch bloß Sohn Adrian zugegen! Doch der ist am Vortag zur Weinmesse nach München abgereist. – Nun rasch die Reitstiefel überstreifen, eine Jahr um Jahr mehr Anstrengung einfordernde Tätigkeit. Kurz kommt dem Reichsgrafen zu Sinn, dass seine Vorfahren für derlei Verrichtungen über bestens ausgebildete Reitknechte geboten ... Als die Prozedur geglückt ist, stampft Graf Rüdiger mit beiden Stiefeln kurz auf. Jetzt sitzen sie richtig.
Vom Haken nimmt er die Trense mit der Linken, den Sattel trägt er auf dem freien Arm. Trotz seiner Nervosität bleibt das Pferd versammelt stehen, lässt sich brav auftrensen und bewegt sich keinen Deut, als die Gurte festgezurrt und die Steigbügel heruntergelassen werden. Doch schon beim Aufsteigen macht sich das überlegende Feingefühl des Vierbeiners wiederum bemerkbar: Ansatzlos will der Schimmel in Galopp fallen, eine in der Tat ungewöhnliche Reaktion. Kaum ein anderes Lebewesen, so heißt es, hat ein solches Gespür für Gefahren entwickelt wie das Pferd – selbst wenn die Bedrohung nicht ihm selbst, sondern seinem Reiter gilt.
Gefrorener Dunst hängt in den Reben. Es ist noch viel kälter als die Tage zuvor. Kaum ein Blättchen hat sich im Gestänge gehalten, an den eingeschrumpelten Geiztrieben hängt Eis. Nach wenigen Metern Schritt setzt sich das Pferd in Trab. Dumpf trappeln die Hufe auf dem bereiften Gras. Indes der Graf bereits auf das Sträßchen zusteuert, das direkt zur Höhe führt, entscheidet er sich noch einmal um und entschließt sich zu einem Umweg: So spät wie möglich sollen die Angreifer mitbekommen, dass hier jemand gegen sie vorgeht. – Lange vergessene Details aus militärstrategischen Schriften schießen ihm durch den Kopf. Wie lange ist das her, seit er sie lesen musste! Nun, kein Zweifel, bestenfalls einen Scheinangriff