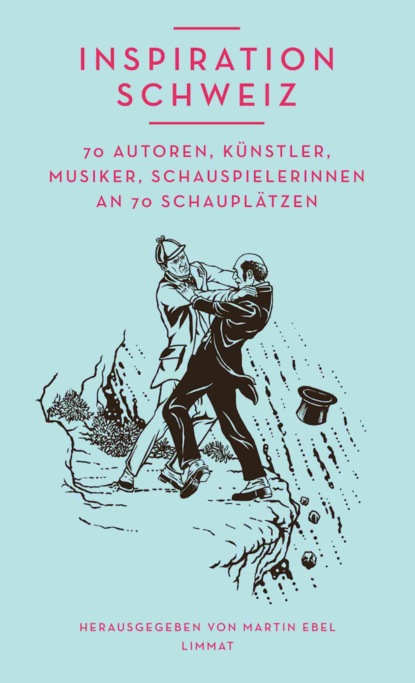Noch während der Zugfahrt lernt er Rogoschin kennen, der im Kampf um die ebenso schöne wie dämonische Nastassja Filippowna zu seinem Widersacher wird.
Von zentraler Bedeutung im Roman ist ein Bild, das Dostojewski während der Durchreise im Kunstmuseum Basel gesehen hatte: «Der Leichnam Christi im Grabe» (1521/22) von Hans Holbein dem Jüngeren. Zwei Meter lang und gerade mal dreissig Zentimeter hoch, zeigt dieses Gemälde im Extremformat einen geschundenen, von der Verwesung im Gesicht und an den Wundmalen bereits stark gezeichneten Christus. Dostojewski war von dem Bild derart fasziniert, dass er unerlaubterweise auf einen Stuhl stieg, um die Details des über Kopfhöhe hängenden Gemäldes besser sehen zu können.
Mit Faszination und Schrecken wird das Bild auch im «Idiot» betrachtet: «Vor diesem Bild kann manchem der Glaube verloren gehen», erklärt Myschkin, als er im Zimmer Rogoschins eine Reproduktion des Gemäldes entdeckt. Und der Student Ippolit stellt die provokative Frage, wie die Jünger angesichts des verwesenden Leichnams glauben konnten, dass Christus auferstehen werde?
Der Einzige, dem im Roman das Bild wirklich zu gefallen scheint, ist der Agnostiker Rogoschin. Gerade er macht sich am Ende des Romans daran, ein Gegenbild zu «erschaffen»: Er ermordet Nastassja Filippowna, entkleidet sie und bahrt sie christusgleich auf seinem Bett auf.
Den entstehenden Verwesungsgeruch bekämpft er erfolgreich mit einigen Flaschen «Schdanowscher Lösung», einem Mittel gegen üble Gerüche. Da er die Leiche zudem mit Tüchern bedeckt, deutet äusserlich nichts auf den Mord hin, und so glaubt Myschkin, als er von Rogoschin ins Zimmer geführt wird, Nastassja Filippowna schlafe.
Nachdem der Mörder gestanden hat, verbringen die beiden die Nacht am Bett der Toten, die mit ihrem scheinbar unversehrten Körper Hoffnung auf Auferstehung und ein besseres Jenseits zu geben scheint. Aber in einem Roman, den Walter Benjamin treffend mit einem «ungeheuren Kratereinsturz» verglichen hat, gibt es keine Hoffnung: Als am Tag darauf die Zimmertür von der Polizei geöffnet wird, ist Rogoschin im Fieberwahn, Myschkin in Apathie versunken.
Auf den Knien betend, verbrachte Dostojewski die Nacht vom 4. auf den 5. März 1868. Gegen fünf Uhr morgens wurde er durch den Schrei eines Kindes erlöst: Er war Vater eine Tochter geworden. Die Freude Dostojewskis war riesig: Ein Monat nach der Geburt berichtet er einem Freund, das Kind habe «bis hin zu den Stirnfalten» bereits alle seine Züge und liege in seinem Bettchen, «als schaffte es einen Roman!»
Acht Tage nach der Taufe, am 24. Mai 1868, starb Sonja «Sonetschka» Dostojewski an einer Lungenentzündung. Ausser sich über die Überheblichkeit des Arztes, die Unerfahrenheit der Kinderfrau und das ungünstige Klima, das er für den Tod seiner Tochter mitverantwortlich machte, verliess Dostojewski mit seiner Frau das «verdammte Genf» und siedelte nach Vevey, schliesslich nach Italien über. Hier schloss er im Januar 1869 seinen Roman ab und kehrte über Prag und Dresden im Juli 1871 nach St. Petersburg zurück.
In die Schweiz kam Dostojewski noch einmal: Im August 1874 reiste er nach Genf und besuchte das Grab seiner Tochter auf dem Friedhof Plainpalais, wo heute noch eine Gedenkplatte an sie erinnert.
Andreas Tobler
Drei Entdeckungen im
Wunderjahr 1905
In der Kantonsschule Aarau lernte er die Eigenverantwortung. An der eth Zürich studierte er Physik. Im Patentamt in Bern reifte die Relativitätstheorie heran.
Es war ein in der Fachwelt unbekannter Wissenschaftler, der innerhalb weniger Monate das Weltbild der Physik aus den Angeln hob. Dabei gehörte der damals 26-jährige Familienvater nicht etwa einer renommierten Universität an, sondern arbeitete Vollzeit als technischer Experte III. Klasse am Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern. Gleich drei bedeutende Arbeiten legte der junge, aus Ulm stammende Physiker Albert Einstein in diesem «Wunderjahr» 1905 vor.
Vieles deutet darauf hin, dass Einstein in der Schweiz Rahmenbedingungen vorfand, die seiner kreativen Schaffenskraft förderlich waren. Schon in der Schulzeit habe Einstein die Schweiz lieben gelernt, sagt der Einstein-Experte Tilman Sauer von der Universität Mainz. Nachdem die Familie von Deutschland nach Italien gezogen war, blieb Einstein zunächst in München, wo er das Luitpold-Gymnasium besuchte. Doch bald schon schmiss er die Schule hin, ging vorübergehend nach Italien und kam über Zürich nach Aarau. Im Oktober 1895 trat Einstein dort in die Kantonsschule ein.
Es begann eine gute Zeit. Wie er in seinen Memoiren festhielt, hat diese Schule «durch ihren liberalen Geist und durch den schlichten Ernst der auf keinerlei äusserlichen Autorität sich stützenden Lehrer einen unvergesslichen Eindruck in mir hinterlassen.» Die Erziehung zur Selbstverantwortlichkeit empfand er dem Drill, den er von Deutschland her kannte, als weit überlegen.
Während seiner Aargauer Schulzeit wohnte Einstein in der Pension Rössligut der Familie Winteler. Bald redete er das Ehepaar mit «Papa» und «Mama» an. Und er verguckte sich in eine der Töchter. «Ein wichtiger Grund für das Wohlbefinden des Maturanden Einstein war zweifellos seine Liebe zu Marie Winteler», schreibt Biograf Alexis Schwarzenbach. Bei der Matura brillierte Einstein in den naturwissenschaftlichen Fächern. In Algebra und Geometrie erreichte er eine glatte 6, in Physik eine 5–6. Nun konnte Einstein wie gewünscht am Zürcher Polytechnikum, heute eth Zürich, Physik studieren. Dort lernte er mit der Studienkollegin Mileva Mari seine spätere Frau kennen.
Nach dem Studium folgte eine schwierige Phase. Einstein konnte partout keine Assistenzstelle ergattern. Er musste sich vorübergehend als Privatlehrer durchschlagen. Erst gut zwei Jahre später, im Juni 1902, entspannte sich die Situation dank der Anstellung am Patentamt in Bern. Die Arbeit gefiel ihm gut. Und mit Michele Besso kam bald ein Freund ans Patentamt, mit dem er sich über seine physikalischen Ideen austauschen konnte. Im Rückblick sagte er über Besso: «Einen besseren Resonanzboden hätte ich in ganz Europa nicht finden können.»
Nach einem gewöhnlichen Arbeitstag war Einstein geistig noch frisch genug für die Wissenschaft und für das Vergnügen. Im «Wunderjahr» schrieb er an seinen Freund Conrad Habicht: «Bedenken Sie, dass es im Tag neben den acht Stunden Arbeit noch acht Stunden Allotria und noch einen Sonntag gibt.»
Am 18. März 1905 ging bei der Fachzeitschrift «Annalen der Physik» in Berlin eine von Einstein selbst als «sehr revolutionär» angepriesene Arbeit ein. Darin postuliert er, Licht sei nicht nur wie bisher angenommen eine Welle, sondern bestehe zugleich aus sogenannten Lichtquanten (Photonen). Damit legte Einstein eine wichtige Grundlage für die Theorie der Quantenmechanik.
Die zweite bedeutende Studie erreichte die «Annalen der Physik» am 11. Mai. Darin erklärte Einstein den willkürlichen Zickzackkurs von kleinen Staubteilchen in Gasen und Flüssigkeiten mit Stössen, die Flüssigkeits- oder Gasmoleküle aufgrund ihrer Wärmebewegung auf die Staubteilchen ausüben. Damit wurde Einstein zu einem Mitbegründer der statistischen Mechanik.
Rund sieben Wochen später schickte er die nächste Arbeit an die «Annalen der Physik». Sie trägt den unscheinbaren Titel «Zur Elektrodynamik bewegter Körper» und enthält das, was heute als Spezielle Relativitätstheorie bekannt ist. Mit ihr widersprach Einstein der Existenz eines das ganze Weltall durchdringenden Äthers, revolutionierte die Vorstellung von Raum und Zeit und postulierte die Lichtgeschwindigkeit als absolute Geschwindigkeitsgrenze.
Quasi nebenbei reichte Einstein im Juli 1905 an der Universität Zürich seine Dissertation ein. Sie thematisiert einen Beleg für die Existenz von Atomen. Kurz darauf lieferte er in einer Art Fussnote zur Speziellen Relativitätstheorie auch noch die bekannte Gleichung E=mc2 ab. Sie beschreibt, welch enorme Energie in der Materie steckt – eine Erkenntnis, die später mit der Explosion der Atombombe äusserst plastisch wurde.
Nach einer Zwischenstation in Prag folgte Einstein im Sommer 1912 einem Ruf an die eth Zürich. «Nun kann ich bald wieder meine Bude in Zürich aufschlagen, zu meiner grossen Freude», schrieb er noch aus Prag an Carl Schröter, den Präsidenten der Naturforschenden Gesellschaft Zürich. Und: «Seit ich hier bin, weiss