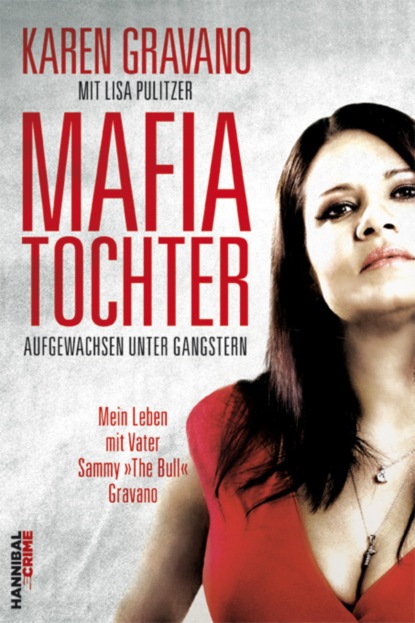Treppe hinab polterte, und rief ihm nach: »Wozu brauchst du denn die Handschuhe? Es ist doch Hochsommer.« In meinem Herzen spürte ich, dass etwas Schreckliches geschehen würde, und ich fürchtete mich.
Er hielt inne, starrte mich an und sagte: »Warum stellst du so viele Fragen?«
»Weiß nicht. Ich habe ja nur gefragt.«
»Eines Tages wird noch eine gute Rechtsanwältin aus dir werden.« Er ging langsam die Treppe wieder herauf, bückte sich und küsste mich auf die Stirn. »Ich verspreche dir, dass jemand bei uns zum Übernachten kommen darf, bevor wir nächste Woche zur Farm fahren.« Die Farm war Papas ganzer Stolz, ein zehn Hektar großer bewirtschafteter Pferdehof im ländlichen Teil von New Jersey. Seit Papa das Anwesen gekauft hatte, verbrachten wir jeden Sommer dort.
»Glaub mir, heute ist kein guter Abend«, sagte mein Vater zu mir. »Ich will, dass du jetzt ein braves Mädchen bist. Du bist die Älteste. Du hast die Verantwortung und musst dich um deinen Bruder kümmern. Und treib’ Mama nicht zum Wahnsinn.« Er küsste mich noch einmal, dann ging er nach draußen.
Mein Vater verstand es ausgezeichnet, mir ungeachtet der tatsächlichen Umstände stets das Gefühl zu geben, alles wäre in schönster Ordnung. Wenn er also an jenem Abend mit einem Revolver im Hosenbund das Haus verließ, würde das schon seine Richtigkeit haben.
Meine Mutter war in der Küche und hatte von unserem Gespräch nichts mitbekommen. Ich hatte nicht vor, ihr zu erzählen, was ich gesehen hatte.
Am nächsten Morgen lautete die Schlagzeile in der Zeitung auf unserem Küchentisch: »Mord vor der Plaza Suite«. Papa war in der Küche und verhielt sich ganz normal. Ich wusste nicht einmal, ob er bemerkte, dass ich den Artikel las. Ich hatte keine, Zeit, ihn ganz zu lesen, aber ich erfuhr, dass das Opfer Frank Fiala war.
Ich wusste, dass der Typ ein paar Sachen gemacht hatte, über die sich mein Vater geärgert hatte. Aber Mord? Als sich mein Vater an den Frühstückstisch setzte, hörte ich sofort auf zu lesen. Keiner von uns sagte ein Wort.
Später in derselben Woche wies mein Vater meine Mutter an, meinen Bruder und mich ins Auto zu packen und zu der Farm in Cream Ridge zu fahren. Als Papa das Anwesen gekauft hatte, war es ziemlich heruntergekommen gewesen. Doch er sagte, es habe Potential und verfüge zudem über ein großes Grundstück. Mein Vater verliebte sich sofort in die Farm. Sobald wir den Besitz übernommen hatten, riss er wieder Wände ein und machte sich gekonnt an die Renovierung.
Bald wurde aus dem abgewirtschafteten Bauernhaus mit ein paar Scheunen und verrosteten Gerätschaften ein spektakuläres Anwesen mit eingelassenem Swimmingpool. Es verfügte über topmoderne Einrichtungen für die Pflege und Ausbildung von Pferden sowie eine professionelle Rennbahn im Vorhof, eine exakte Nachbildung des Freehold Raceway in New Jersey. Mein Vater stellte einen Trainer aus dem Stall in Staten Island an, wo mein Bruder und ich Reitunterricht hatten, und baute ihm ein kleines Haus auf dem Gelände. Die meisten Pferde, mit denen der Trainer arbeitete, waren Traber, die auf dem Meadowlands Racetrack Rennen liefen. Mein Vater restaurierte sogar die alte Pferdekutsche, die ein früherer Besitzer zurückgelassen hatte.
Es beunruhigte mich, dass wir so plötzlich und ohne Papa zur Farm aufbrachen. Eigentlich wollten wir erst ein paar Tage später fahren. Die Farm war ein Ort, an dem meine Familie stets viel Spaß hatte. Es gab dort immer etwas zu tun. Sie lag etwa eine Stunde und fünfundvierzig Minuten von Staten Island entfernt im historischen Cream Ridge. Verglichen mit Staten Island war die Gegend sehr ländlich. Es gab mit Bäumen bestandene Hügel, schmale zweispurige Straßen und viele große Pferdehöfe. Allein für die nicht asphaltierte Ruckelpiste, die zu unserem Haus führte, brauchte man mit dem Auto fünf Minuten.
Das Haupthaus war riesig und bot atemberaubende Blicke über unsere zehn Hektar Grasland. Als wir es kauften, war die Fassade weiß; mittlerweile war sie grau. Es war umgeben von einer schönen, steinernen Veranda mit einem großen Tisch und vielen Gartenstühlen. Ich fand das Haus klasse. Mein Zimmer war oben, mit Blick auf die Rennbahn, was mir sehr gut gefiel. Ich ritt gerne und verbrachte viele Stunden mit meinem wunderschönen weißen Pony Snowflake. Auf Staten Island ritt ich mit einem englischen Sattel, auf der Farm hingegen im Westernstil.
Wir verbrachten den Großteil des Sommers in Cream Ridge. Mama werkelte gerne im Garten herum, und mein Bruder Gerard fuhr mit dem Fahrrad querfeldein über das riesige Anwesen. Während des Sommers pendelte Papa hin und her. Meist verließ er dienstags die Farm und kehrte donnerstags wieder zurück. Mein Vater war ein ganz anderer Mensch, wenn er auf der Farm war. Dann saß er morgens auf der vorderen Veranda, schlürfte seinen Kaffe und sah den Trainern auf der Rennbahn zu. Er wirkte stets entspannt, als könnte ihn nichts auf der Welt aus der Ruhe bringen.
Oft lud er Freunde und ihre Familien aus New York ein. Ich wusste es damals noch nicht, aber all diese Freunde waren Mitglieder der Mafia. Mein Vater hatte eine feste Regel: Auf der Farm wurde nicht übers Geschäft gesprochen. »Wenn ihr kommt, bringt eure Overalls mit, weil jeder mit anpacken muss«, pflegte er zu sagen. Wir hatten viel zu lachen. Es waren immer Leute zu Besuch, und ständig wurde irgendwo gebaut.
Doch an jenem Tag, als uns Papa zur Farm vorausschickte, verlief nicht alles nach den Regeln. Es begann damit, dass er unerwartet eintraf. Kurz vor dem Abendessen hörte ich, wie der Kies in der Einfahrt knirschte. Ich rannte zum Fenster und sah, wie Papas brauner Lincoln vor dem Haus hielt, gefolgt von mehreren anderen Wagen. Mein Vater hatte uns gesagt, er würde erst in einigen Tagen nachkommen.
Doch nun war er da. Und damit nicht genug: Er hatte »Stymie« bei sich im Auto. Stymie war Joe d’Angelo, der beste Freund meines Vaters. Papa sagte, er habe ihn »auf der Straße« getroffen. Die beiden Männer waren sich so sympathisch, dass sie sich mit ihrem braunen Haar und ihrer untersetzten Statur sogar ähnelten, wenngleich Stymie mit seinen über ein Meter siebzig gute sieben Zentimeter größer war als mein Vater. Sie kleideten sich auch gleich, trugen ähnliche Trainingsanzüge und Turnschuhe. Stymie besaß eine Bar in Brooklyn namens Docks. Papa hatte ihn einmal als seine rechte Hand bezeichnet.
Als mein Vater aus dem Wagen stieg, trug er sein weißes T-Shirt und eine Sporthose. Stymie trug ein Sweatshirt über seinem Hemd. Seine Frau war nicht mitgekommen, was sehr ungewöhnlich war. Wenn Papas Freunde zu Besuch kamen, brachten sie immer ihre Familien mit. Onkel Eddie und einige andere von Papas Leuten stiegen aus den anderen Fahrzeugen. Keiner hatte Frau und Kinder dabei.
Ich rannte hinüber in die Küche, um meinen Vater zu begrüßen. Er redete in gedämpftem Ton mit meiner Mutter. Ich sah, wie sie den Kopf schüttelte. »Okay«, flüsterte sie, bevor sie meinem Papa ins Freie folgte.
An jenem Abend servierte Mama das Dinner draußen auf der hinteren Veranda, die komplett mit Mückengittern verkleidet war. Entlang des Fundaments verlief eine niedrige Mauer, auf der die Gitter und Rahmen ruhten. Wenn ich die Gespräche meiner Eltern belauschen wollte, konnte ich mich dahinter verstecken und war nicht zu sehen. Ich nutzte diese Möglichkeit recht häufig, um Diskussionen über meine Wünsche zu verfolgen, etwa, wenn ich meine Eltern gefragt hatte, ob wir den Great Adventure Amusement Park besuchten. Wenn ich sie gefragt hatte, verschwand ich aus dem Zimmer und schlich mich dann von der Rückseite des Hauses wieder an, um zuzuhören, wie sie ihre Entscheidung fällten.
An jenem Abend aber hatte ich das Gefühl, dass Papa nicht er selbst war. Seine Stimmung ängstigte mich. Ich merkte immer sofort, wenn er etwas auf dem Herzen hatte. Dann wurde er still und starrte ins Leere. Ich war mir sicher, dass etwas passiert war, und überzeugt, dass es mit der Pistole und dem Mord vor seinem Nachtclub zu tun hatte. Ich wollte gar nicht daran denken, dass er darin verwickelt sein könnte.
»Hilf deiner Mama beim Aufräumen«, sagte mein Vater zu mir nach dem Abendessen. Ich räumte den Tisch ab, dann fragte ich ihn, ob er mir zusehen wolle, wie ich auf Snowflake ritt.
»Nein, ich komme später raus«, sagte er. »Ich rede gerade mit den Jungs.«
Mama war noch in der Küche, als ich mich außen um die Veranda herum schlich und zu meinem Versteck kroch. Ich lehnte mit dem Rücken an der Wand, saß im Indianersitz und lauschte. Das hatte ich noch nie zuvor getan, ein Gespräch meines Vaters mit seinen Freunden belauscht. Aber ich wollte wissen, was vorgefallen war.
»Paul