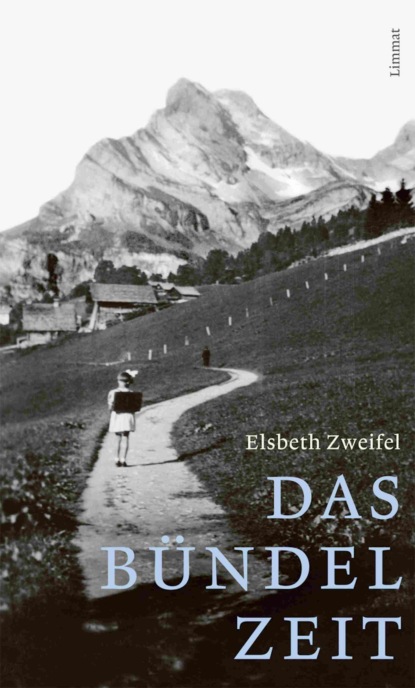meinen Kopf geflogen, und Fini schrie: «Du Zaupf …» Und schon war Mutter in der Tür und schrie mit ihrem Sopran die zweite Stimme. Ich rannte und verkroch mich, weinte aus Wut und Verlassenheit. Die zwei Frauen begannen mich zu suchen, später brachten sie mir das Essen.
Je nach Saison kamen noch andere Frauen wie Alba, Gretel und Giuseppina aus Italien, Österreich und Jugoslawien. In Deutschland war Krieg.
Die Eltern, der Lehrer und der Pfarrer im Tal fanden es nicht gut, wenn man den Kindern immer alles erklärte. «Sie erfahren es noch früh genug», war ihr Satz. Während des Krieges war dieses Schweigen gross, gross wie die Hürbi in der Allmend, und der aufsteigende Rauch stach in die Nase.
Auch wir Kinder sagten den Eltern nicht alles: Dass wir im Tal unten ein Ohr auf das Bahngleis legten und auf das Rauschen und Klopfen des nahenden Zuges warteten. Ein Lokomotivführer von der sbb beklagte sich, und meine Eltern wurden per Telefon gewarnt.
Auch das Rauchen von Nielen und Zigis blieb unsere Sache, manchmal sah man auf dem alten Dach ein Räuchlein aufsteigen.
Dies war im Tal der Linth und auf dem Orenberg in den Vierziger- und Fünfziger-jahren des letzten Jahrhunderts.
Dreissig Jahre später, nach einer Durchgehung dieser mir vertrauten Landschaft, empfand ich eine mir nicht erklärbare Trauer, Vertrautheit und gleichzeitiges Fremdsein. Ist dies ein Zustand des Erinnerns?
Welche Sprache spricht die Erinnerung? Was passiert in mir, wenn sich die zwei Welten treffen, damals, heute?
Bilder, Worte, Stimmungen beginnen zu sprechen, suchen einen Ort der Vertrautheit. Das Blühen der Erikas und der Duft der grünen Minze.
Die Landschaft verändert, die Figuren die gleichen. Während des Erzählens stiegen der Autorin immer neue Figuren auf, Figuren, die sprechen wollten. Sie beginnt mit ihnen zu spielen, auch zu streiten. Wie die Farben sein sollen, hell oder dunkel, wie ihr Denken, ihre Sprache oder ihr Handeln sein sollen.
Ich nehme die Fäden in meine Hände, manchmal lasse ich sie gehen, bis mir mein Körper ein Signal gibt. Ob das Rot auf dem Stein Blut war oder im Regenwasser vermoderte rote Blütenblätter, dies erfahren wir später.
Was geschieht, wenn da einfach nichts, Leere ist?
Lieber Vater
Heute war ich wieder einmal auf dem Oren, dort wo Du so gerne warst, dort, wo unser Haus stand, dort wo die Wand war.
Ich weiss nicht, wie lange diese Pläne in Deinem Kopf brodelten, mit dem heimlichen Wissen, dass dies ein wunderschöner Ort ist, mit dem unheimlichen Wissen, dass dies ein Ort des Unheils werden könnte.
Als ich im Hotel unten, im Tal des silbergrauen Flusses, auf die Welt kam, warst Du traurig, dass ich kein Bub war. Ich war das dritte Mädchen.
«Gut so», sagte Mutter, «was willst Du noch mehr, es ist schön, hat alle Glieder, und es ist gesund.»
Damit das Kind dort oben auf dem Berg, in diesem alten Bauernhaus, nicht erfrieren müsse, befahlst Du Mutter, ihre Brüste mit Kampfer einzustreichen, sie einzuschnüren. Dem Kind Kuhmilch mit Wasser, immer von der gleichen Kuh, zu geben und es für ein Jahr bei Deiner Mutter, meiner Grossmutter, im Tal des silbergrauen Flusses zu lassen.
Ich war eine junge Frau, als Mutter mir dies eines Tages erzählte. Nach diesem Jahr habe sie mich kaum mehr erkannt, ich sei still und ruhig im Bettchen gelegen, und als sie sich über mich neigen und mich küssen wollte, hätte ich geschrien, kaum mehr geatmet.
Stundenlang hielt sie mich in ihren Armen, sei mit mir herumspaziert und hätte die Dinge im Haus laut beim Namen genannt. Jetzt bleiben Mutters Worte in meinem Hals stecken, ich weine. Mutter weint, Trost finden wir keinen.
Nun bin ich alt und wandere auf dem Oren herum. Ich könnte die Augen schliessen, und mein Herz würde jedem Ort die richtigen Farben zuteilen.
Vater, hier auf dem schmalen Strässchen blicke ich zum Schluchen hinunter, ein schmaler, steiler Abhang mit Wildheu, und ich weiss, dass hier Dein erster Versuch war, aus einem kleinen Bach Elektrizität in unsere Stube zu bringen.
Vieles gelang Dir, und manchmal durfte ich meine kleine Hand in Deine legen, mit Dir dort hinuntersteigen. Wenn Dein Gesicht auf Schön zeigte, sass ich auf Deinen starken, Schultern und ich sah für eine kurze Zeit Deine Vaterwelt. Ich hätte gerne meine kleinen Hände auf Deine Augen gelegt und «Hüüühh» geschrien, dies wäre mein Glück, aber auch unser gemeinsames Unglück geworden.
Dieser gemeinsame Ort des Unheils blitzte auf, verschwand. Dort zu verweilen, ihn zu betrachten, mit ihm zu sprechen, dazu war keine Zeit. Gäste Tag und Nacht, das Bähnli, drei Kinder, der Hund, die Katzen … und eine schwarze Sau.
Ich bewunderte Dich, Du konntest Licht machen, Trinkwasser ins Haus legen, eine Luftseilbahn bauen und mich darin zur Schule fahren lassen.
In mir erfroren die Holunderblüte
Heiri und Margarethe und ihr kleiner Sohn Heireli, unsere Nachbarn.
Ruedi, Heiris Bruder und Knecht, mit Marie, seiner Braut. Alle auf dem Berg, alle unter demselben Dach.
In der Küche ein grosser, schwarzer französischer Holzkochherd, zeitweise züngeln ein paar Flammen bedrohlich neben der Pfanne in den dunklen Raum hinein. Ein kupfernes Wasserschiff auf der linken Seite, darauf der weisse Emailkrug mit dem Kaffee für den ganzen Tag. Unter der Treppe zur oberen Kammer ein Küchentisch, darüber die grüne Petroleumlampe aus Heiris Familie.
Auf der Bergseite eine Bank, ein Holzhocker auf der Talseite.
Daneben die niedrige Stube, in der Mitte ein Schiefertisch mit vier Holzstabellen, der Kachelofen mit der Ofenbank. Die Wärmeluke in Heiris und Margarethes Schlafkammer steht noch offen.
Unter den kleinen Schiebefenstern ein hellblauer Plüschdiwan aus Margarethes Familie. Margarethe liebt diesen blauen Diwan, und heimlich kontrolliert sie die Hosen, die sich daraufsetzen möchten.
Margarethe ist eine Frau aus dem Tal, genauer aus dem Grosstal in der Nähe der Stadt Glarus.
Es ist Feierabend. Der Berg, die Steine, das Gras und die Menschen still. Nur der Brunnen vor dem Haus plätschert.
Ruedi sitzt vor dem Haus, auf der kleinen verwitterten Bank. Sein Gesicht noch jung, wären da nicht die tiefen Furchen auf seiner Stirn. Der Kopf ruht auf seiner Brust, und von der Nase droht ein Wassertropfen zu fallen.
In seiner linken Hand die Tabakspfeife, kalt, seit gestern kein Gruss.
Neben ihm liegt sein Schwyzerörgeli. Ein feines Lederband hält die Luft und die Töne verschlossen.
Heireli, ein lustiger Kerl, steht vor der Bank, seine Hände stecken in den Hosentaschen, und seine Augen ruhen auf Ruedi.
«Ruedi, komm essen, die Polenta steht auf dem Tisch, für dich und Vater bleibt noch ein Stück Speck.»
Wie eine lästige Fliege weist Ruedi Heireli von sich. Kein Wort, kein Blick, nur diese Geste, dieses Wegwischen mit seiner rechten Hand. Heireli verschwindet in der Küche, seine Augen dunkel.
Margarethe und Heiri am Küchentisch warten. Die Polenta auf ihren Tellern kalt.
In der Küche brennt ein Petroleumlicht.
Fünfzig Jahre später erzählt mir Heireli. Seine Worte wühlen sich nach aussen, stolpern über seine Lippen.
An diesem Morgen in der Früh, es sei ein kühler Morgen gewesen, habe Marie auf dem blauen Diwan gesessen, ihr blonder Zopf im Nacken zerzaust. Sie habe leise geweint, ihre Hände seien sanft über den blauen Diwan, über ihren Bauch gestrichen.
«Immer dieses Weiss. Diese Kälte, dieser Schnee, in mir erfroren die Holunderblüte. Der Berg in meiner Brust gibt keine Ruhe, und die Luft in mir will nicht mehr weichen.»
So habe sie leise vor sich hin gesprochen, und in ihren Augen habe ein Schneelicht