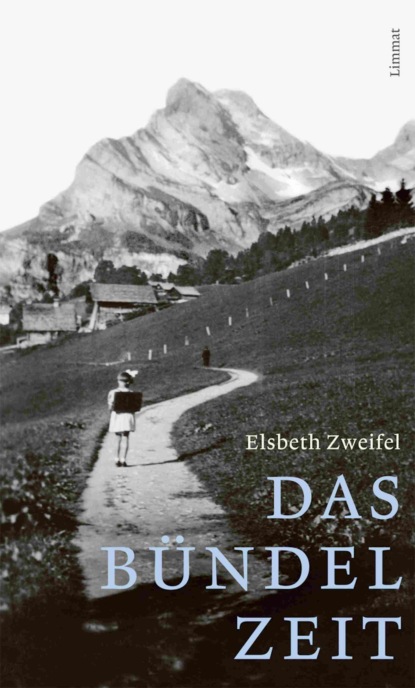könne er dieses Bild malen. Er habe Marie nicht wiedergesehen. Sie habe den schmalen Weg ins Tal genommen, ins Tal der Linth, des silbergrauen Flusses.
Vielleicht nicht so schlimm
Auf dem Berg schneit es, seit Stunden, Tagen. Flocken wie Leintücher, sie fallen leicht und schwer. In ihrem Weiss verstummen Worte, Rufe, Namen. Wegen des Schnees hat das Kind in dieser Nacht in Braunwald auf dem Berg, nicht bei den Eltern geschlafen.
Auf dem Weg zur Schule verschwinden die Köpfe der Kinder im Schnee. Von Sepp, auf dem Weg zum Stall, ist nur seine Mütze zu sehen, sie schaukelt wie ein Boot in Not. Um neun Uhr sitzen sieben Schüler atemlos auf ihren Plätzen, reiben sich die Hände, und wie immer setzt sich Lehrer Faust auf die zweite Schulbank links, und die Kinder ahnen es, er wird nicht über den Tagesablauf sprechen, er schaut in die Runde, wirft einen Blick durchs Fenster und spricht mit ungewohnt leiser Stimme. Dass wegen des grossen Schnees einige Kinder zu Hause, andere stecken geblieben sind, er habe um sieben Uhr früh eine Nachricht erhalten … Alles sei noch nicht klar, vielleicht nicht so schlimm, aber es habe wahrscheinlich Tote gegeben, man wisse noch wenig, er wendet sich mir zu und sagt: «Du kannst gehen, wenn du willst.» Dann wird seine Stimme alt wie immer.
«Du kannst gehen, wenn du willst», hat er gesagt. Schneeränder fallen mir auf die Füsse, an den Wimpern zittern Schneewassertränen, dann kriechen sie wie kleine Tierchen über meine Wangen, verschwinden im Weiss. Die Füsse tasten sich eine grau-weiss geahnte Spur entlang, mein Körper nach vorne geneigt, Schritt um Schritt.
Eben zuckt mein Körper zusammen, ich bleibe kurz stehen, meine Augen zu, das Kinn auf der Brust. Bilder tauchen auf, im Kopf ein leises Grollen, im Hals eng. Ich muss weiter, ins Dorf hinunter.
Mit der Standseilbahn fahre ich ins Tal, dann mit Vaters Luftseilbahn auf den Oren, wo man noch nichts weiss. Alles sei noch nicht klar, vielleicht nicht so schlimm, hat Lehrer Faust gesagt. Wären nur meine Beine nicht so schwer, im Kopf das Grollen, jetzt laut.
Nicht stehen bleiben, nicht müde werden, hat die kranke Mutter dem Gritli gesagt, nur an das Feuer, den wärmenden Ofen denken und wissen, dass dann, wenn du mit dem feinen Holz zurück bist, ist deine Mutter wieder gesundet. Dann hat sich das Gritli auf das Mäuerlein gesetzt, nur einen Augenblick …
Meine Finger springen, zittern auf den weissen Tasten hin und her, auf und ab, auf dem Bildschirm lauter fette, schwarze Buchstaben, sie drohen zu stürzen, alle grossen Hs und Rs fallen aus dem Text, Wörter, Sätze bäumen sich auf, brechen wie Schneewellen, kommen ins Rutschen.
Die Finger noch auf den Tasten, jetzt ruhig, auf dem Bildschirm folgende Zeilen:
Die Mauer mit frischem
Schnee bedeckt
Auf der Bergseite duftet
Noch der Thymian und
Dort beim verdorrten Holunder
Trieb der Wind den Toten
Schnee in die Augen.
Hoch in der Luft
Schreien die Dolen
Ruedi, sieben Tage, sieben Nächte unter dem Schnee, Mund, Nase, sein Stottern, die Pfeife im Mund, sein Lächeln für Marie, seine Braut, erstickt im Schnee.
Auch Heiri, Heirelis Vater, erstickte in dieser Lawine, aber man fand ihn sehr früh, er wurde bei uns im Esszimmer aufgebahrt, und seine Frau, Margarethe, half meiner Mutter, ihm einen Gurt mit goldenen Kühen anzuziehen, ein Schmuckstück aus dem Appenzellerland.
Heireli steht daneben und fragt:
«Mutter, weshalb trägt Vater sein Sonntagshemd und den Ledergürtel mit den goldenen Kühen?»
«Er kann sie nicht sehen, denn seine Augen sind für immer zu.»
«Mutter, gibt es dort auch neue Kälbchen, die nicht trinken, denen Vater mit zwei Fingern helfen muss? Trocknet er dort auch das Neue mit Heu und Stroh?»
«Mutter, nimmst du mich mit, wenn du morgen die Kühe melken gehst?»
«Der Schnee ist mannshoch, und du, Heireli, bist ein Dreikäsehoch.»
«Ich melke jetzt meine Kuh, jene, die Vater mir geschnitzt. Und lege sie dann auf seine Sonntagsbrust.»
Ich schaue aus dem Stubenfenster, es schneit. Zürich, erster Schnee, Dezember 2010.
Ein Jahr später
Auch diesen Winter fallen die Flocken schwarz. «Eingeschneit», sagt Mutter. Vater «Bunkerschlaf». Ich schweige. Im Gemüsekeller stehen drei Notbetten mit drei Bettflaschen aus Metall.
Mutter und ich in langen, barchentenen Hemden, Vater in langen Trikotunterhosen und Wollhemd, so liegen wir auf diesen Latten. Warten auf den Schlaf. Warten. Warten auf den stündlichen Anruf von der Polizei, sagen, dass es uns noch gibt, sagen «Gute Nacht». Warten auf das eine Wort. In unseren Köpfen ein Geschwür, von der Kehle gehalten. Wir horchen. Horchen auf das Schlagen in unserer Brust, auf den Atem des Anderen, ein leises Schnarchen, horchen auf die stehende Luft, auf unser Eingeschlossensein. Und horchen auf das Licht des Tages. Das vertraute Ticken der Stubenuhr hinter den Balken, erstickt.
Das Aufschrecken beim ersehnten Klingeln. Das Flackern des Lichts, die grünblassen Gesichter. Nacht für Nacht. Jetzt dieser Anruf ausserhalb der geraden Stunden, eine Dame meldet ein Ferngespräch aus London, bleiben Sie bitte am Apparat. Dann meine Schwester Afra, sie will alles wissen, wo und wie, und dass sie ganz fest an uns denken wolle und dass sie auch an das Jahr zuvor, an den Januar 1951 denke. Jetzt klingt ihre Stimme heiter, fast fröhlich. «Mutter, ich habe mich verliebt, und ich bin glücklich. Mutter, ich habe mich in einen Neger verliebt, er ist schön, Mutter. Adieu meine Lieben, schlaft gut.»
Wir sitzen auf unseren Betten, Mutter wischt mit den Händen über ihr Gesicht, Vaters Augen gross und offen. Wieder dieses Horchen. Suchen nach dem Schlaf. Ich, ein junges Mädchen, an den Neger denkend, ein Häppchen fremdes Glück im Keller erstickt.
An diesem Morgen fühlt sich das Hinaufsteigen in die Küche leichter an, das Licht blauweiss wie die Magermilch. Ich sehe Albert, unseren Knecht, der in seiner Kammer geschlafen, die Kühe gemolken, und die jungen Katzen, die mit ihren Pfoten am Rande der Tanse hängen und ihre tägliche Magermilch trinken. Ein Blick aus dem Fenster, auch heute fallen die Flocken schwarz. Draussen klettert der Schnee an den Fenstern empor, bleibt ein paar Sekunden hängen, fällt in sich zusammen. Liegt am unteren Rande, beginnt zu wachsen, fällt. Da steht das Kind, und die Flocken tanzen, wachsen. Und die Menschen beginnen mit den Flocken zu tanzen, wachsen, verweilen, fallen. Frauen, Männer, Kinder, der Neger und das Glück wirbeln durcheinander, tanzen miteinander, bleiben unten am Fenster …
Dann dieses Klingeln. Wir kennen es, wir wollen es nicht hören. Mutter, Vater, Afra, der Neger, Albert und ich, wir sind hier, und alles ist gut, und wie glücklich wir sind, und das Tanzen geht weiter, die Augen leuchten und die Musik wird immer lauter, schneller … Ein fürchterliches Grollen, Schreie aus dem Schnee, Tassen, Teller, Lampen klirren. In den Augen des Kindes nichts als Schnee, Schnee aus Grau, Schnee aus Blau, Schnee aus Rot, und die Dunkelheit springt aus allen Ecken.
Dies war im Jahr zuvor.
Da höre ich eine Stimme, zunächst leise, dann lauter. Jemand nimmt mich sanft an der Hand. «Komm wir essen.» Albert an der Zentrifuge, während die Katzen mit den Pfoten ihre Mäuler, ihre Ohren putzen. Auf dem Teller die Butter, die Konfitüre, in den Tassen dampft frischer Kaffee. Vater, Mutter, Albert und ich am Tisch.
Die Lawine unten.
Im Tal der Betrieb der sbb eingestellt.
Die rote Puppe
Das Haus stand zwischen dem Gurnigelgrat
Und dem Lattenzaun beim Abgrund
Eine Steinmauer, weisse Nelken, der Pfad schmal
Da lag Mutters Garten
Im Frühsommer blühten Bohnen und Kefen und
Im