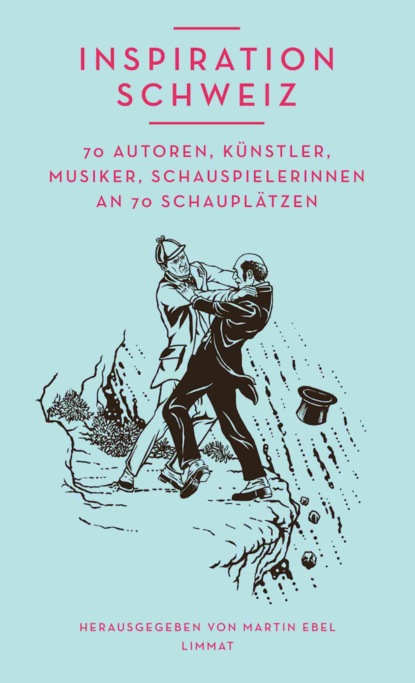war ein Frühaufsteher; morgens bereitete er sich seinen Kaffee selber (die Kaffeemaschine hatte er aus Wien mitgebracht) und ging dann spazieren; am Ufer entlang, auf die Hügel, über Wiesen und durch den Wald. Dabei flogen ihm die Einfälle zu, die er dann in der Wohnung ausarbeitete. «Alle Welt kennt ihn, wenn er, im Wollhemd, leichtem Rock und Beinkleid, aber ohne Weste und Halstuch, oft auch ohne Kragen, den Hut in der Hand, stundenlange Wege in der Umgebung macht», berichtet ein Zeitgenosse.
Ausserordentlich inspirierend muss der Anblick der Natur mit ihrem lieblichen Vordergrund und dem grandiosen Gebirgspanorama auf den gebürtigen Flachländer gewirkt haben. So «voller Melodien» sei die Landschaft, «dass er aufpassen muss, dass er nicht drauftritt», heisst es in einem Brief. Einige sind in die A-Dur-Sonate eingegangen. Diese ist aber natürlich kein Natur-, sondern ein Kunstprodukt, gespeist auch weniger von Natur- als von Kunstverweisen.
Dass die Sonate mit derselben Tonfolge beginnt wie das Preislied aus Wagners «Meistersingern», ist Zufall. Regelrecht zitiert finden sich dagegen mehrere Lieder aus eigener Feder; im Seitenthema des ersten Satzes erklingt «Wie Melodien zieht es», Verweise gibt es auch auf «Komm bald», ein weiteres Lied nach Versen seines norddeutschen Landsmanns Klaus Groth, und auf «Mein Lieb ist schön wie die Sonne». Das waren sozusagen musikalische Vertraulichkeiten, denn die Sonate ist «in Erwartung der Ankunft einer lieben Freundin» geschrieben, wie Brahms verriet. Dabei handelte es sich um die Sängerin Hermine Spies, die zweimal auf einen Tag hereinschaute und mit Brahms neue und alte Lieder am Klavier durchnahm.
Auch in Bern, wohin es ihn am Wochenende immer wieder zog, sorgte er für musikalische Unterhaltung, trug zwar mit Vorliebe Bach vor, war sich aber auch nicht zu schade, der Jugend zum Tanz aufzuspielen. Auch besuchte er mit grossem Vergnügen Operettenaufführungen im «Schänzli».
Zu einer engeren Zusammenarbeit mit Widmann kam es dagegen nicht; dieser hatte darauf gehofft, Brahms werde ein Opernlibretto von ihm vertonen. Aber mit der Oper hatte der Komponist ebenso abgeschlossen wie mit Heiratsplänen. Stattdessen bedichtete umgekehrt Widmann die «Thuner Sonate», nachträglich. Er entwarf mit blühender Fantasie einen Traum von einem Ritter und einem Mädchen, das in einem Feennachen fährt, gezogen von Libellen. Der Traum verfliegt, das Lied bleibt: «Doch, mag es klingen auch vor tausend Ohren / im Fürstensaal, in stolzen Städten viel – / Es bleibt doch unsres Landes, hier geboren / An dieses klaren Flusses Wellenspiel.» So bleibt, dürfen wir verstehen, die A-Dur-Sonate Thun zugehörig. Brahms jedenfalls hat das Gedicht sehr gemocht.
Martin Ebel
Vom Himmel kommt es,
zur Erde muss es
Mit seinem Herzog wanderte Goethe zum Staubbachfall. Er regte ihn zu seinem Gedicht «Gesang der Geister über den Wassern» an.
Zweieinhalb Stunden braucht man heute aus dem geschäftigen Zürich bis nach Lauterbrunnen. Goethe, der von Basel kam, liess es 1779 gemächlicher angehen. Er wählte auch nicht die Direttissima. In neun Tagen tastete er sich über Moutier, Biel, Bern und Thun bis in das damals schon berühmte Trogtal vor, zu Fuss, in einem «engen Wägelgen» oder per Schiff. In seiner Begleitung: Diener mit Gepäcktieren, der «schöne Wedel» (Kammerherr Otto Moritz von Wedel) und Goethes Chef, der Herzog Ernst August, in dessen Dienst er seit vier Jahren in Weimar stand.
Goethe war dreissig, der Herzog zweiundzwanzig; das Alters- und Intelligenzgefälle kontrastierte mit dem ständischen Abstand, der zwischen einem Herzog und einem Bürgerlichen (auch wenn dieser Geheimrat und Minister war) damals zwangsläufig bestand. Eigentlich war das Verhältnis noch komplizierter: Goethe war zugleich Kumpel (in den Anfangsjahren hatten die beiden gewaltig über die Stränge geschlagen) und Fürstenerzieher; die Schweizer Reise sollte die Persönlichkeit des jungen Landesherrn durch gezielt ausgewählte Eindrücke – Natur, Kultur, Menschen – bilden und veredeln.
Das erforderte viel Fingerspitzengefühl und fiel Goethe nicht immer leicht. In einem Traum hatte er sich schon mit ihm überworfen und war ihm davongelaufen. Aber auch der Herzog hatte es nicht immer leicht mit Goethe, der ihm im November eine Tour auf den Furkapass abverlangte, durch tiefen Schnee und von einem Geier als einzigem Lebewesen begleitet. Lauterbrunnen war verglichen damit ein Kinderspiel. Man kam im Pfarrhaus unter, das dafür eingerichtet war, Touristen aufzunehmen: Und die gab es schon im ausgehenden 18. Jahrhundert durchaus. Das Tal mit seinen 72 Wasserfällen zählte zu den Pflichtstationen jeder ordentlichen Schweizreise. Highlight, das man damals nur noch nicht so nannte: der Staubbachfall mit seinem fast 300 Meter freien Fall.
Albrecht von Haller hatte ihn in seinem epochemachenden Lehrgedicht «Die Alpen» gewürdigt, aber den poetischen Text, den wir heute noch mit diesem Fall verbinden, schrieb natürlich Goethe: den «Gesang der Geister über den Wassern».
Irgendwann zwischen dem 9. und dem 11. Oktober 1779 muss er, auf den unmittelbaren Eindruck hin, die freien, reimlosen Verse niedergeschrieben haben; denn danach drängten sich mit der Grossen Scheidegg und den Reichenbachfällen schon neue Bilder dazwischen. Dem Brief an Charlotte von Stein, der am 14. Oktober von Thun abging, lag das Manuskript des Gedichts bei. «Kein Gedancke, keine Beschreibung noch Erinnerung reicht an die Schönheit und Grösse der Gegenstände, und ihre Lieblichkeit in solchen Lichtern Tageszeiten und Standpunckten.» Nur die Dichtung kann den Eindruck bewahren: indem sie ihn transformiert.
Ursprünglich waren die sechs Strophen auf zwei Stimmen verteilt; in der Fassung des Erstdrucks 1789 hat Goethe den Dialog aufgegeben zugunsten eines Geisterchores. Der spricht nicht aus den Wassern selbst, sondern über ihnen schwebend; der Tonfall ist ruhig, fast dozierend. Der Wasserkreislauf («Vom Himmel kommt es, / zum Himmel steigt es, / Und wieder nieder / Zur Erde muss es, / Ewig wechselnd») inspiriert den Dichter zu einer metaphorischen Deutung der menschlichen Seele: Auch diese ist himmlisch und irdisch zugleich.
In den Mittelstrophen folgt der Dichter dem Strahl auf seinem weiteren Weg, von Klippen aufgehalten, dann schleichend im flachen Bett des Wiesentals, «Und in dem glatten See / Weiden ihr Antlitz / Alle Gestirne». Es ist Gedankenlyrik, die aber die Prägung des Eindrucks in einer Fülle von Alliterationen aufbewahrt (strömt / steil / Strahl / stäubt allein in der zweiten Strophe); wenn man will, steht der Doppelkonsonant st für die Klippe, das harte Element; das w (Wiesental, Weiden, Wind, Welle, Wogen) für die Weichheit des Wassers.
Es bleibt der einzige lyrische Ertrag dieser Reise; der Rest ist Prosa – Tagebuch und Briefe, die Goethe später zusammengefasst und bearbeitet als «Briefe aus der Schweiz» herausgab: als wichtigen Schritt weg vom ichbezogenen Sturm und Drang hin zur objektiveren, klassischeren Einstellung gegenüber der Natur und ihren ewigen Gesetzen. Ein anderer, für das klamme Herzogtum eminent wichtiger Ertrag war ein Kredit, den der Herzog vom Kanton Bern bekam. Starke Eindrücke gewann der junge Monarch unter Goethes Führung neben der Furka-Gewalttour noch im Mer de Glace bei Chamonix, als menschliche Sehenswürdigkeit wurde ihm in Zürich Lavater vorgeführt («er ist die Blüte der Menschheit, das Beste vom Besten», fand Goethe damals noch).
Und heute? Die Verkehrssprache in Lauterbrunnen ist Englisch, asiatisches Englisch. In indischen, japanischen und chinesischen Reiseführern müssen die Wasserfälle des Lauterbrunnentals eine ähnliche Rolle spielen wie im 18. Jahrhundert für die bildungsreisenden Europäer. Der Staubbach ist schon vom Zug aus gut zu erkennen, man begreift sofort, woher er seinen Namen hat: als ob da unentwegt Sandfuhren über die Klippe geschaufelt würden. Das Wasser scheint einen vierten Aggregatzustand zu erreichen: Zertrümmert durch den gewaltigen Aufprall, fliegen die befreiten Moleküle schwerelos durch die Luft (das ist natürlich unwissenschaftlich, aber in Goethes Nähe erlaubt, der auch noch nichts vom Periodensystem wusste).
Man hat einen Tunnel zum Berg geschlagen, der auf eine Galerie führt, sodass man den Wasserfall von innen nach aussen betrachten kann. Die Gemeinde bittet um Spenden; sie will die Galerie noch um 30 Meter verlängern; eine noch grössere Attraktion für unsere asiatischen Freunde. Am Fuss des Tobels findet sich der «Gesang der Geister» in Metall graviert; sonst erinnert nichts mehr an den Besuch