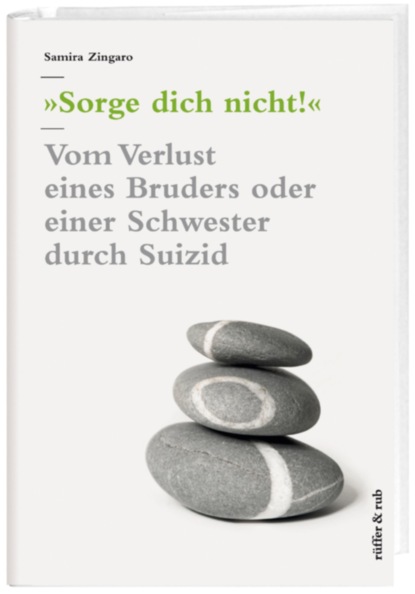vernichteten Suizidenten das von Gott geschenkte, heilige Leben – ein für Augustinus deutliches Zeichen für Ungläubigkeit. Im 6. Jahrhundert beschlossen die Konzilien, dass durch eigene Hand Gestorbene nicht kirchlich bestattet werden durften – diese Praxis wurde bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts vollzogen. Die Leichen wurden deshalb, analog zu Schwerstkriminellen, außerhalb der Friedhofsmauern beigesetzt. Ab dem 12. Jahrhundert galt Suizid für die Kirche als Todsünde. Das Rechtsbuch des katholischen Kirchenrechtes (CIC) verurteilte den Suizid, der entsprechende Kanon wurde erst Anfang der 1980er-Jahre gestrichen.1 Vertreter der Katholischen Kirche betonen inzwischen, dass sie nicht die Suizidenten verurteilt, sondern die Handlung, auch wenn eine Selbsttötung unter anderem der Liebe zum lebendigen Gott widerspreche.2
Die christliche Kirche stand Suizidhandlungen lange Zeit nicht sonderlich verständnisvoll gegenüber.
Das ist richtig, und bis heute äußert sich die katholische Kirche zum Thema Suizid kritisch. In der Tat fühlen sich aber gewisse Standesvertreter dazu berufen, ihre Ansichten und ihren Glauben als Standard auszugeben. Meiner Meinung nach wird das Gottesvolk immer mehr von Ansichten der Oberen vor den Kopf gestoßen. Die mitunter geäußerten Meinungen zeugen von einer alarmierenden Unkenntnis der Ur-Kunde des Glaubens – sowohl des jüdischen als auch des christlichen. Kaum jemand von diesen Personen hat je zur Kenntnis genommen, dass im Alten Testament der Bibel von einer Tötung auf Verlangen und von acht Suiziden die Rede ist. Kein einziger dieser ›außergewöhnlichen Todesfälle‹ wird auch nur mit einem impliziten – geschweige denn expliziten – negativen Kommentar gewürdigt. Im Gegenteil. Einige der durch eigene Hand Verstorbenen wurden ›im Grabe ihrer Väter‹ beigesetzt – der höchstmöglichen Würdigung, die einem Verstorbenen zu biblischen Zeiten zuteilwerden konnte.
Wie kamen Sie als ausgebildeter Chemiker dazu, Theologie zu studieren?
Kurz nach unserer Heirat brachen meine Frau und ich nach Indien auf. Dort reisten wir während drei Monaten vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln.Auf der Reise durch dieses riesige Land,zusammen mit einfachen Menschen und oft ihren Ziegen und Hühnern im Abteil, kamen wir in enge Verbindung mit den Glaubensvorstellungen der Mitmenschen.Wir erlebten aus nächster Nähe das Leben und Sterben der Bewohner unseres Gastlandes. Sehr vereinfacht könnte ihr Leben unter folgende Formel gestellt werden: ›Geboren, erzogen und religiös sozialisiert werden – den Verdienst des Lebensunterhalts erlernen – eine eigene Familie gründen – das Anerzogene und Gelernte weitergeben – die Heiligen Schriften studieren und sich vorbereiten auf den Tod.‹ Wir waren von dieser Gesamtschau eines Lebens so fasziniert, dass wir uns damals sagten, auch für uns wäre es sinnvoll, die Heiligen Schriften zu studieren und uns auf den Tod vorzubereiten. Wir gründeten in Folge eine Familie und ein medizinisch-diagnostisches Dienstleistungslabor und nutzten eines Tages die Möglichkeit,dieses florierende Geschäft zu veräußern. Als der skeptische amerikanische Käufer fragte, was ich wohl nun zu tun gedenke, antwortete ich spontan: ›Theologie studieren.‹
Als nach dem Abschluss des Theologiestudiums die Frage nach der Doktorarbeit aufkam, entschloss ich mich, mich vertiefter mit dem Sterben und dem Tod auseinanderzusetzen.
Warum ausgerechnet das Thema Suizid?
Ich wurde mit dieser extremsten Möglichkeit des menschlichen Handelns seit meiner Jugendzeit immer wieder konfrontiert und versuchte deshalb, Antworten darauf zu finden. Beim ersten Mal befand ich mich in der Ausbildung zum Laboranten, ich bekam einen Gerberlehrling zugewiesen, der einen Einblick in elementare, chemische Verfahren erlernen wollte. Eines Tages hieß es, er habe sich das Leben genommen. Ich konnte das damals im wahrsten Sinne des Wortes weder verstehen noch irgendwie nachempfinden. Immer wieder nahmen sich in den darauffolgenden Jahren Menschen in meinem Umfeld das Leben, Personen, von denen ich glaubte, sie gut gekannt zu haben. Nichts hätte mich vermuten lassen, dass sie eines Tages so weit gehen würden.Weder vermochte ich diese Suizide in mein Weltbild einzuordnen, noch war ich fähig, mich nach dem Ergehen bei den nächsten Hinterbliebenen zu erkundigen. Nach längerer Zeit besuchte ich in einem Fall schließlich doch die Eltern einer Bekannten. Ich bat ihre Mutter und ihren Vater um Verzeihung für mein langes Schweigen. Sie sagten mir, ich müsse mich nicht entschuldigen, es sei nach dem Tod ihrer Tochter niemand gekommen, um mit ihnen darüber zu reden. Diese Begegnung war für mich der Auslöser für meine späteren Aktivitäten auf diesem Gebiet.
Sie gründeten und leiteten Selbsthilfegruppen für Zurückgelassene nach Suizid.
Mich interessierte die Frage der seelsorglichen Begleitung Hinterbliebener nach dem Suizid eines Nächsten besonders. In einer Selbsthilfegruppe teilen die Anwesenden ihr Schicksal, müssen keine Ausreden suchen und stellen fest, dass sie nicht die Einzigen mit dieser Last sind. Um mit diesen Trauernden in Kontakt zu treten, gelangte ich an ›Regenbogen‹ – eine der ersten Selbsthilfeorganisationen der Schweiz. Dort bekam ich die Gelegenheit, den Ablauf einer offenen Selbsthilfegruppe kennenzulernen. Da es sich bei diesem Verein um Hinterbliebene handelt, die ein Kind durch Suizid verloren hatten, wurde ich gewahr, dass es nichts dergleichen für Hinterbliebene nach dem Verlust einer Partnerin oder eines Partners durch Suizid gab. Auch die Funktionsweise der Gruppen schien mir nicht optimal. So begann ich Menschen um mich zu sammeln, denen die Verarbeitung eines Partnerverlustes durch Suizid ein Anliegen war.Von Anfang an achtete ich darauf, dass eine Gruppe mindestens sechs und höchstens zehn Teilnehmende umfasste und dass die regelmäßigen Zusammenkünfte sich über ein ganzes Jahr erstreckten. Sensible Daten, wie Geburtstage oder Weihnachten, werden dann miteinander erlebt.
In den Gruppen werden Themen wie Schuld, Scham, Sexualität oder Partnersuche angesprochen. Zudem erhalten die Betroffenen die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte zu erzählen. Es geht darum zu teilen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Sich mitzuteilen, also miteinander etwas teilen. Unter meiner Leitung zündeten wir jeweils eine Kerze an, und die Teilnehmenden konnten ihre Geschichte schildern, sie anschließend zu Hause niederschreiben und an einer folgenden Zusammenkunft erneut vortragen. Diese Praxis wird zum Teil bis heute betrieben. Die Verschriftlichung hat einen weiteren Vorteil: Liest man die Geschichte in fünf, zehn, ja zwanzig Jahren nochmals, merkt man, wie man weitergekommen ist.
Ihre größten Erfahrungen mit Hinterbliebenen machten Sie via Internet.Wie kamen Sie bereits in den 1990er-Jahren darauf, dass in diesem Bereich eine Nachfrage besteht?
Der Pionier für Internet-Seelsorge ist und bleibt Pfarrer Jakob Vetsch. Er hat die Internet-Seelsorge ins Leben gerufen und holte mich damals ins Boot, um die Rubrik ›Verlust und Trauer‹ zu betreuen. Er suchte ehrenamtlich Mitarbeitende, die bereit waren, ihr spezifisches Fachwissen einzubringen. Hatten die Hilfesuchenden einmal Vertrauen gefasst, entstanden intensive schriftliche Dialoge aus E-Mails, die bis zu sechs Seiten lang waren. Und während ich an der Analyse des mir Geschriebenen arbeitete, kamen andere E-Mails herein, die etwa lauteten: ›Ich kann nicht mehr. Jetzt mache ich Schluss.‹ Solche Zeilen erfordern eine unmittelbare Antwort. Zu Beginn dachte ich, ich formuliere fixfertige, schön klingende Sätze, die wie ein Pflaster auf jede Wunde passen. Doch nicht ein einziges Mal konnte ich einen solchen Satz brauchen, zu individuell waren die Geschichten. Beim E-Mail-Verkehr ging es in erster Linie darum, Antworten auf das zu suchen, was einem widerfahren ist, oder wie es weitergehen soll. Ich bot den Schreibenden von Anfang an das Du an. Und natürlich schrieb ich von meiner Anteilnahme und meiner Hilf- und Machtlosigkeit angesichts der mir mitgeteilten Widerfahrnisse: ›Ich bin hilf- und machtlos. Ich fühle mich in Anbetracht dessen, was dir passiert ist, zutiefst erschüttert. Und ich bin außerstande, dir zu helfen, wie du das vielleicht von mir erwartest. Ich kann nichts machen, muss hinnehmen, was du mir anvertraust. Aber ich möchte mit dir ein Stück des Weges gehen, bis du ihn wieder vertrauensvoll alleine gehen kannst.‹
Worin unterscheidet sich das persönliche Gespräch vom virtuellen Kontakt?
Das geschriebene Wort wiegt mehr als das gesprochene. Ein persönliches Gegenüber ist konkret, drückt sich verbal und nonverbal aus, redet mehr oder weniger frei und hat zugleich Angst, zu viel von sich und seinen Gefühlen preiszugeben, oder fürchtet, falsch verstanden zu werden. Als Gegenüber muss ich damit rechnen, beurteilt oder gar abgelehnt zu werden, dazu bedarf es einer anspruchsvollen Gesprächskultur. Schweigen etwa muss man aushalten können. Dieses Mitteilen des Erlebten wird wegen Schuld- und Schamgefühlen sehr oft durch die physische