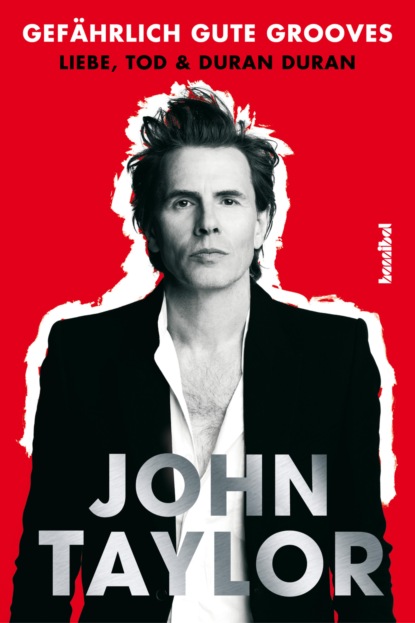„Tel Aviv“ erreicht den Schlussteil. Auf geht’s.
Der Vorhang hebt sich vor unserem neuen Leben.
Bis unter das Dach reichen die PA-Türme, die unsere Instrumente verstärken. Doch ihre ganze Power ist machtlos gegen die sexuelle Energie, die aus dem jugendlichen Publikum auf uns zu wogt.
Ihre Kraft ist fast greifbar. Ich spüre den ganzen ersten Song hindurch, wie sie sich meiner Arme, Beine und Finger bemächtigt. Unablässig branden ihre Wellen auf die Bühne.
Wir haben keine Chance, uns Gehör zu verschaffen, aber das macht nichts. Es hört uns sowieso niemand zu. Sie sind gekommen, um sich selbst zu hören. Um gehört zu werden. Und was sie zu sagen haben, ist: „Nimm mich, MICH! Ich gehöre dir! John! Simon! Nick! Andy! Roger!“
Als unser erster Song mühsam stolpernd zum Halten kommt, sehen wir uns gegenseitig hilfesuchend an. Aber irgendwie hat der nächste Song schon ohne uns angefangen. Wir haben die Kontrolle verloren. Sitze werden zertrümmert. Kleider heruntergerissen. Es gibt Verletzte. Zusammenbrüche. Eine Szene wie von Hieronymus Bosch. Alle weiblichen Teenager Großbritanniens erleben zeitgleich ihre Jugend-Krise, genau jetzt, mehr oder weniger im Takt unserer Musik. Der Wahnsinn ist ansteckend. Wir sind der Auslöser für ihre Explosionen, eine nach der anderen, tausendfach.
Wir sind zu Idolen geworden, zu Ikonen. Objekten der Anbetung.
Teil 1: Analoge Jugend
1: Hey Jude
Ich bin vier Jahre alt. Aufgeweckt und schüchtern. Die Haare sind blonder als später in meiner Teenager-Zeit. Ich trage Shorts und Sandalen und bin ein kleiner Prinz der Vorstadt im Süden von Birmingham, in Hollywood. Wie perfekt.
An einem typischen Wochentag des Jahres 1964 bin ich um zehn Uhr morgens aus dem Haus geschlüpft und hüpfe auf dem rauen Beton der Einfahrt herum. Ich sehe zu, wie meine Mum die Haustür zuzieht, abschließt und den Schlüssel in ihre Handtasche legt; die Handtasche verstaut sie in ihrer Einkaufstasche, und es geht los. Links aus der Einfahrt heraus und den Hügel hinauf, das ist die Straße, in der wir leben, die Simon Road. Unser Haus ist die Nummer 34, das vorletzte der Straße.
Wir gehen zusammen den Fußweg entlang und zählen abwärts: 32, 30, 28. Auf der linken Seite der Straße stehen all die Doppelhäuser mit den geraden Hausnummern, jede Hälfte ein separates Eigenheim (unseres steht Seite an Seite mit der Nummer 36). Die Gebäude mit den ungeraden Hausnummern auf der anderen Straßenseite sind freistehende Wohnhäuser, allesamt weit größer als unseres, was auch für die baumreichen, langgestreckten Gärten gilt, die unten an ein Flüsschen grenzen. Auch sind die Auffahrten ebener und bieten Platz für mehr als ein Auto.
Als ich später statusbewusster wurde, fragte ich meine Eltern: „Warum habt ihr damals nicht sechshundert Pfund draufgelegt, dann hätten wir jetzt einen Bach im Garten?“
Ich halte Mums Hand und denke an den Beatles-Song, der so oft im Radio läuft, als der Anstieg steiler wird. Wir erreichen den Kamm des Hügels, wo die Simon Road auf die Douglas Road trifft, und biegen rechts ab.
Wir kommen an einem vier Meter hohen Holly-Busch, einer Stechpalme, vorbei, der einzige mir bekannte Hinweis darauf, woher die Siedlung ihren Namen hat. Wir marschieren weiter, überqueren die Hollywood Lane auf Höhe des Gay Hill Golf Clubs, eine Einrichtung, die ich später in meiner Vorstellung als Schauplatz von Partnertauschpartys mythisch verklären werde. Nicht dass irgendjemand aus meiner Familie diese Stätte jemals betreten hätte, und an dem Gerücht war auch nichts dran.
Autos rasen vorbei, mit vierzig oder gar fünfzig Kilometern pro Stunde. Wir erreichen die Highter’s Heath Lane, eine weitere Verkehrsader der Gegend, die man nehmen muss, wenn man das alte Birmingham der Omas, Tanten und Onkel, der Erholungsparks und gepflegten Grünanlagen besuchen will. An den Wochenenden ist die Familie Taylor viel auf dieser Straße unterwegs. Auch Mutter und Sohn müssen sie benutzen, um ihr heutiges Ziel zu erreichen: die Pfarrkirche St. Jude.
Diese ganze Lauferei. Wir machen das, seit ich denken kann. Mum fährt nicht selbst Auto und wird es nie tun. Zuerst saß ich in meinem Kinderwagen, aber jetzt bin ich so alt, dass ich neben ihr her gehen kann, was eine Erleichterung für sie sein muss. Ich klage nicht, es ist halt so und wird immer so sein. Amen.
Mum schwitzt jetzt in ihrem Wollkleid und dem Regenmantel, sie will endlich ankommen. Wir passieren die Esso-Tankstelle, in der ich 1970 meine Sammlung von Gedenkmünzen zur Fußballweltmeisterschaft vervollständigen werde. Eine letzte Biegung nach links und wir sind auf dem gepflasterten Platz, wo die Kirche von St. Jude in ihrer Waschbeton-Pracht steht.
Als ich älter war, habe ich viele wunderschöne, beeindruckende Kirchen gesehen: St. Patrick in der Fifth Avenue, den Petersdom in Rom, Notre Dame in Paris. Aber in der ganzen westlichen Welt gab es keine zweckmäßigere Kirche für das Volk als St. Jude in der Glenavon Road. Man hatte sie in der unmittelbaren Nachkriegszeit als Provisorium für ein paar Jahre gebaut. Jetzt geht sie auf die Zwanzig zu, es zieht und klappert an allen Ecken. Der Bau ist einstöckig, hat ein Wellblechdach und auf seiner gesamten Länge alle zwei Meter ein Fenster.
Diese Schlichtheit verstärkte bei den Gläubigen von St. Jude die Vorstellung, auserwählt zu sein. Warum sonst sollten wir uns an diesem kalten, hässlichen Ort versammeln, wenn wir nicht gewiss sein konnten, dafür belohnt zu werden?
Pater Cassidys großartige Spendenkampagne in den Siebzigerjahren hatte schließlich eine neue St.Jude’s-Kirche zum Ergebnis. Das war keine geringe Leistung. Keiner der Kirchgänger war wohlhabend oder gar reich. Alle mussten auf den Penny achten. Von diesen Gemeindemitgliedern Geld einzusammeln, um davon eine neue Kirche zu bauen, erforderte viel Überredungskunst.
Zum Glück hatte der Pater Gott auf seiner Seite.
Unser Sinn für Gemeinschaft führt uns durch die kleine Eingangshalle, wo auf einfachen Holztischen Bücher ausliegen; manche muss man kaufen, andere sind kostenlos. Es gibt Sachbücher, Bibeln, Liederbücher und andere Artikel wie Rosenkränze, Kruzifixe und Schmuckanhänger in Gestalt des Heiligen Judas Thaddäus, des Schutzpatrons der hoffnungslosen Fälle.
Weiter ins Mittelschiff, wo es nach Schweiß und Weihrauch vom Vortag riecht. Meist ist es kühl hier drin, manchmal warm, aber nie heiß. Ein großer, rothaariger Mann spielt auf einer klapprig aussehenden Orgel, aus deren Pfeifen zarte, flüchtige Musik ertönt. Eno würde sie atmosphärisch nennen. Träge brennende Kerzen verströmen einen gottgefälligen Duft.
Schlag elf beginnt die Messe. Der Priester kommt schick gekleidet herein, gefolgt von zwei jungen Männern in weißen Gewändern – das Team des Geistlichen, seine Truppe. Einer von ihnen schwenkt einen silbernen Kelch, aus dem noch mehr Weihrauch strömt. Die Luft in der Kirche muss gründlich gereinigt werden, bevor der gute Pater sie einatmen kann.
Er trägt eine kunstvolle Robe aus grün-goldener Seide mit einem roten Kreuz auf dem Rücken. Unterhalb des Umhangs geben die knöchellangen, umgekrempelten Hosenbeine den Blick auf schwarze Socken und Straßenschuhe frei.
Die Musik schwillt an, und wir stehen alle auf. Der rothaarige Mann leitet uns in ein Lied, das wir alle gut kennen, „The Lord Is My Shepherd“. Ich öffne das Gesangbuch, um den Text zu lesen. Ich mag dieses Lied, aber wie Mum bin ich zu verlegen, um laut mitzusingen. Ich wünschte, ich könnte es, aber es geht einfach nicht. Doch ich mag das Gemeinschaftsgefühl, das entsteht, wenn alle im Raum dieselben Worte singen.
Als das Lied zu Ende ist, schreitet der Priester zum Podium. Er blickt hinunter auf seine Bibel, öffnet weit seine Hände und sagt: „Lasst uns beten.“
2: Jack, Jean und Nigel
Die Kirche war einfach da. Wie der Strom, die Heizung oder das Schwarzweiß-Fernsehen – etwas, das