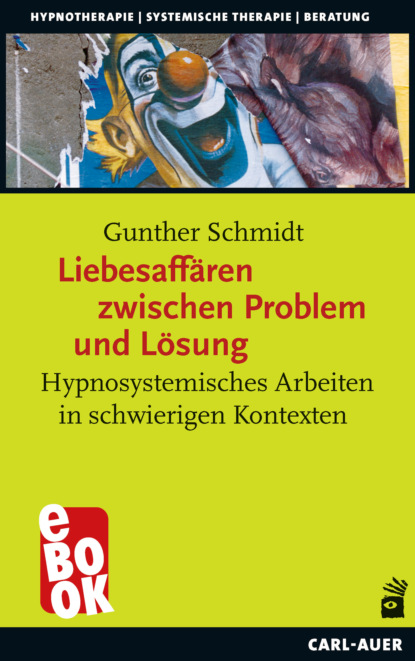Annahmen und Vorgehensweisen in beiden Konzepten.
Mit hypnosystemischen Interventionen kann ein System nun sowohl intrapsychisch als auch interaktionell schnell und nachhaltig verändert werden. Mit ihnen können selbst bei als sehr schwer wiegend, „hartnäckig“ und chronifiziert geltenden Problemen zufrieden stellende Entwicklungen schnell, kostengünstig und nachhaltig angeregt werden. Dies zeigen in ermutigender Weise die Ergebnisstudien, die wir seit 1997 an der Fachklinik am Hardberg in Siedelsbrunn (wo die Modelle auch stationär umgesetzt werden) durchgeführt haben (vgl. Spilker 1999, 2002, Schauer 2000, Herr 2002, Zwack 2003, Harfst et al. 2004).
Der hypnosystemische Ansatz verbindet, wie ich jetzt begründen will, die zentralen Vorteile dieser Konzepte und vermeidet dabei gleichzeitig die Nachteile.
Auf den ersten Blick allerdings mag es rätselhaft erscheinen, wie Modelle aus der Tradition der Hypnose gerade für die systemische Arbeit nutzbar sein sollten. Auch mir ging es so, als ich begann, mich mit Hypnose und insbesondere mit dem ericksonschen Hypnotherapieansatz zu beschäftigen. Gestoßen war ich auf diese Konzepte zunächst durch Hinweise von Helm Stierlin und dann dadurch, dass ich entdeckte, dass fast alle relevanten Interventionstechniken der damaligen systemischen Therapie (wie z. B. positive Konnotationen, Symptomverschreibungen etc.) ihre Wurzeln in der ericksonschen Hypnotherapie haben. Nachdem ich ab 1977 die Arbeit einiger direkter Schüler von Erickson (J. Zeig, S. Gilligan, P. Carter) in Deutschland kennen gelernt hatte, hatte ich 1979 das Glück, noch bei Milton Erickson selbst lernen zu können. Die Erfahrungen, die ich bei ihm machte, haben mein gesamtes Denken und Handeln, damit natürlich auch mein Verständnis von meiner Arbeit, nachhaltig bis heute verändert. Seitdem versuche ich, die systemischen Therapiekonzepte und die der ericksonschen Hypnotherapie zu einem immer differenzierteren integrativen Modell zu entwickeln. Dies hat die systemische Arbeit, wie in diesem Buch gezeigt wird, sehr verändert, umgekehrt hat sich aber durch meine systemische Sicht auch das Verständnis vieler Hypnotherapievorstellungen verändert (seit Anfang der 1980er-Jahre wirke ich als Ausbilder der Milton-Erickson-Gesellschaft mit an der Verbreitung der ericksonschen Ansätze).
Zunächst war ich Konzepten der Hypnose gegenüber äußerst kritisch und abwehrend. Aus meiner Sicht gibt es kein Verfahren im Feld der Psychotherapie, das so überfrachtet ist mit Vorurteilen, Zerrbildern und Missverständnissen wie die Hypnose – denen auch ich unterlag. Diese Vorurteile lassen sich aus ihrer Geschichte und aus vielen Mythen erklären, die auch durch Filme, Cartoons, Bühnenhypnoseshows etc. immer wieder verstärkt werden. Assoziationen zu merkwürdigen Ritualen, die den Eindruck machen, irgendwelche charismatisch machtvoll auftretende Anbieter (Hypnotiseure) würden mithilfe abstruser Kommunikationsformen fast willenlosen, passiv-rezeptiven Klienten (Hypnotisierten) ihren Willen aufschwatzen, beherrschen bis heute die Vorstellungen von Hypnose der meisten Menschen in unserer Kultur, auch vieler Therapeuten. Die Erkenntnisse der Autopoieseforschung und generell der modernen Hirnforschung belegen klar, dass diese Vorurteile weitgehend obsolet sind und dass man von außen letztlich niemanden völlig dazu bringen oder zwingen kann, ein Angebot von außen gegen den eigenen Willen anzunehmen und seinen Inhalt umzusetzen. Ich will hier auf diese geschichtlichen Aspekte nicht weiter eingehen, sondern die hirnphysiologisch gut belegbaren Abläufe charakterisieren, die für unsere Arbeit nützlich sein können.
Die Begriffe „Hypnose“ und „Trance“
Schon dadurch, wie diese Begriffe meist verwendet werden, entsteht leicht Verwirrung. Mit dem Begriff „Hypnose“ werden in der hypnotherapeutischen Fachwelt üblicherweise alle die Interaktions- und Kommunikationsprozesse gemeint, die rituell eingesetzt werden (entweder als Fremd- bzw. Heterohypnose oder als Selbst- bzw. Autohypnose), um bestimmte Erlebnis- und Bewusstseinszustände anzuregen, die meist als „Trance“ bezeichnet werden. „Trance“ meint also das gewünschte Ergebnis der Prozeduren, die als „Hypnose“ bezeichnet werden. Unter „Trance“ wird in unserer Kultur meist verstanden, dass sich jemand passiv-rezeptiv, kataleptisch, tief entspannt, ganz nach innen gerichtet, mit geschlossenen Augen intensiv absorbiert quasi in einer anderen als der üblichen Konsensus-Realitäts-Welt (also der „normalen“ Welt) erlebt, oft so „abwesend“ oder auch wie schlafend, dass er danach, wenn er sich wieder in das „normale“ Alltagswachbewusstsein zurückorientiert, dafür eine Amnesie erlebt. (Der Begriff „Hypnose“ wurde 1842 von James Braid vorgeschlagen und von dem griechischen Wort hypnos = Schlaf abgeleitet.) In diesem „Zustand“ verändern sich auch physiologische Prozesse, Alphawellen im EEG nehmen zu etc. Sehr detaillierte phänomenologische Beschreibungen solcher „Trance“- Zustände finden sich in allen klassischen Lehrbüchern zur Hypnose (siehe z. B. Kossak 1989; Bongartz u. Bongartz 2000).
Solche Trancezustände werden therapeutisch jeweils als Mittel eingesetzt, um das Erreichen bestimmter gewünschter Ergebnisse zu unterstützen, z. B. Analgesie bei Schmerzen, Entspannung, Unterstützung bei der Entwöhnung bei Suchtproblemen, hilfreiche Imaginationen bei Ängsten etc.
Wie weltweite anthropologische und ethnologische Studien aber zeigen, ist dieses seit ca. 250 Jahren speziell in Europa kultivierte Verständnis von Trance viel zu eng und zu einseitig (Bongartz u. Bongartz 2000; Goodman 1994). Die Arbeit mit Trance ist überall auf der Welt seit offenbar mindestens 10 000 Jahren wesentlicher Bestandteil praktisch jeder menschlichen Kultur und wurde und wird besonders für Heilungszwecke und bei religiösen Anlässen intensiv genutzt. Das kulturvergleichende Studium zeigt aber deutlich, dass von Gesellschaft zu Gesellschaft sehr unterschiedliche Arten von Prozessen zur Entwicklung von Trance (Induktion) genutzt und auch sehr unterschiedliche Erlebniszustände als Trance erzeugt werden. In Jäger-und-Sammler-Kulturen (die über die längsten Zeiträume der menschlichen Evolution die vorherrschenden Kulturen waren) wurden z. B. so gut wie nie Entspannungstrancen produziert, sondern solche mit viel Bewegung, sozialer Interaktion, mit optimaler körperlicher Spannung, Gesang und Tanz und niemals mit Amnesie etc. Dies ist nicht überraschend, denn Trance war immer ein Mittel zum Zweck und sollte bestimmten Zielen dienen, insbesondere in diesen Kulturen der Vorbereitung erfolgreicher Jagd, auf der man es sicher nicht gebrauchen könnte, ganz entspannt die Aufmerksamkeit auf die eigenen Innenwelt zu richten.
Der traditionelle europäische Trancebegriff sollte also unbedingt erweitert werden. Entspannungstrancen können sehr angenehm und wertvoll sein, bewirken aber keineswegs grundsätzlich immer Hilfreiches. Ob sie hilfreich wirken, hängt ab vom Kontext, für den man Trance als Hilfsmittel einsetzen will, und vom angestrebten Erleben, welches als zieldienlich angesehen wird. Und besonders relevant ist es, ob die Trance einen wichtigen Unterschied einführt in die bisher problemstabilisierenden Muster. Sind diese z. B. gekennzeichnet durch ein relatives Übergewicht an Passivität, Rezeptivität, Entspannung und Introversion und werden diese Tendenzen im Erleben einer Entspannungstrance womöglich verstärkt, würde dies keine Neuinformation bewirken, im besten Fall würde es nichts Relevantes bewirken.
Obwohl die zahlreichen Konzepte zur Hypnose, die es weltweit gibt, zum Teil sehr unterschiedliche Auffassungen repräsentieren, sind sich alle wichtigen Modelle in einigen zentralen Punkten einig. Der wesentlichste für unsere Themen hier ist der eines qualitativen Verständnisses von Tranceprozessen: Es wird davon ausgegangen, dass alles Erleben, welches von den Beteiligten als „Trance“ definiert wird, immer gekennzeichnet ist dadurch, dass dabei unwillkürliches Erleben (also Erleben im Sinne von „Es passiert ganz unwillkürlich“) vorherrscht, wohingegen im üblichen Wachbewusstsein mehr das Erleben vorherrscht von „Ich mache es willkürlich“, also willkürliches Erleben. Trance wird allgemein aufgefasst als Erlebnisweise, in der im Spektrum des Erlebens von willkürlicher Kontrolle zu mehr unwillkürlicher Selbststeuerung des Organismus übergeleitet wird (Beahrs 1982). Subjektiv werden solche Prozesse meist erlebt, als ob sie wie automatisiert abliefen. Sie erscheinen umso intensiver, je mehr das Erleben der Beteiligten absorbiert wird in diese quasi automatisiert ablaufenden Prozesse, je mehr man sich als davon wie erfasst oder als darin „versunken“ erlebt. Beschreibt man „Trance“-Prozesse so, findet man übrigens erhebliche Verwandtschaft mit „Flow“-Erlebnissen (Csikszentmihalyi 1996).
Genau dieses Phänomen des Absorbiertseins hat wohl auch den Erfinder des Hypnosebegriffs, James Braid, schon kurz, nachdem er den Terminus „Hypnose“ vorgeschlagen hatte, dazu bewegt, ihn wieder zu revidieren und dafür zu werben,