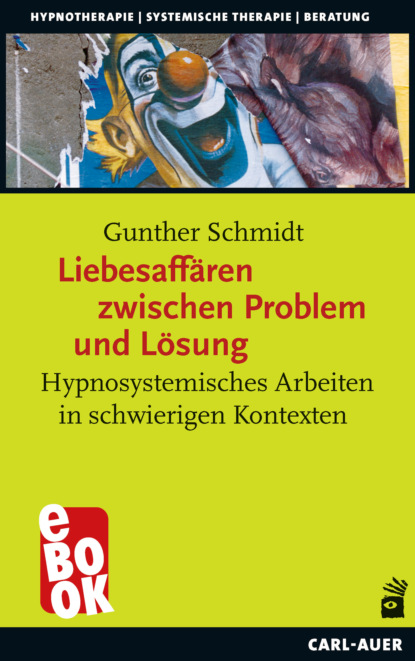was sie nun für die therapeutische Praxis heißen. Die komplexen systemtheoretischen Konstrukte müssen übersetzt werden auf praktisches Handeln in Therapie und Beratung. In diesen Kontexten geht es in aller Regel eben nicht darum, schöne akademische Metabeschreibungen zu entwerfen in Bezug darauf, wie man die Dynamik von Systemen verstehen könnte. So etwas wäre in Therapie oder Beratung allenfalls einmal ein Mittel zum Zweck. Vielmehr sind dies immer Kontexte, in denen Menschen in aller Regel mit spezifischen Anliegen kommen und eine professionelle Dienstleistung in Auftrag geben. Diese Kunden und Kundinnen (in manchen Kontexten wie z. B. dem „Gesundheitswesen“ – welches wohl besser „Krankheitswesen“ genannt würde – werden sie immer noch z. B. „Patienten“ und „Patientinnen“ genannt) kommen mit der berechtigten Erwartung, dass dann auch von den Auftragnehmern (Therapeuten und Therapeutinnen, Berater und Beraterinnen) spezifisch etwas geleistet wird, das ihren Anliegen dient. Alle Maßnahmen und Angebote an die Kunden sollten konsequent daraufhin geprüft werden, ob sie diesen Anliegen effektiv dienen, die Güte eventueller Interventionen sollte auch daran abgelesen werden. Wir brauchen also eine auftragseffektive Umsetzung systemischer Theorie in die Praxis.
In den meisten Fällen werden an Therapeuten bzw. Berater Aufträge mit Veränderungserwartungen herangetragen. Wie dann damit umgegangen wird, hängt wieder davon ab, wie man sich a) die Entstehung und Aufrechterhaltung von Problemen und Symptomen und b) die Entwicklung von Veränderung und, daraus folgernd, c) die Rolle und Aufgaben von Therapeuten bzw. Beratern vorstellt.
In den diversen „traditionelleren“ Therapieverfahren gibt es typischerweise bestimmte Annahmen darüber, was für eine hilfreiche, gesundheitsförderliche Entwicklung in der Therapie nötig sei. Diese heben je nach Konzept auch sehr unterschiedliche, teilweise sich auch widersprechende Aspekte hervor, z. B. die Idee, man müsse zunächst im therapeutischen Prozess die „Übertragung“ sich entwickeln lassen, die man dann zu analysieren habe, um die Genese der Probleme im geschichtlichen Kontext zu „verstehen“ und „durchzuarbeiten“, emotionale Prozesse müssten aktiviert, eventuelle emotionale „Blockaden“ aufgelöst, Lerndefizite aufgefüllt werden etc.
In der systemischen Arbeit aber geht man davon aus, da ja jede Realität ohnehin als jeweils konstruiert verstanden wird, dass ein Problem Ausdruck von ungünstig wirkenden Realitätskonstruktionen (individuell und interaktionell) in bestimmten Kontexten ist. Hinzu kommt als wichtiges Kriterium, wie man sich aus systemischer Perspektive das Erzeugen von Information vorstellt. Information entsteht aus dieser Sicht jeweils durch das Bilden von Unterschieden, Information ist der Prozess und das Ergebnis von Unterschiedsproduktion. Deshalb versucht alle Therapie, „im weitesten Sinne die Beschreibungen zu verändern, über die Wirklichkeit erfahren wird“. Sie erscheint als „ein gemeinsames Ringen um Wirklichkeitsdefinitionen. Alle psychologischen Maßnahmen verändern, wenn sie erfolgreich sein sollen, die Art und Weise, wie in der Familie übereinander, über Probleme, über psychische Störungen, Krankheit und die damit zusammenhängenden Optionen gesprochen wird. Sie verändert also die den Betroffenen gemeinsamen Sinnstrukturen im Kontext eines jeweiligen Systems“ (von Schlippe 1995, S. 23 f.). Dies sollte nicht nur kognitiv, sondern auch durch konkrete leibliche Erfahrungen geschehen.
Dieses Grundverständnis nun lässt wieder viel Raum dafür, wie man Veränderungen anregen könnte. Die Entwicklungsgeschichte der Familientherapie allgemein und der systemischen Therapie im Besonderen weist da viele teilweise übereinstimmende, teilweise recht weitgehend voneinander abweichende Konzeptionen auf, die auf Anwender (wie ich durch viele entsprechende Kommentare bei vielen Weiterbildungen und Supervisionen weiß) häufig nicht hilfreich, sondern eher verwirrend wirken. Ich selbst hatte die Gelegenheit (und das Glück?), seit Mitte der 1970er-Jahre praktisch alle relevante Entwicklungen der Familientherapie und der systemischen Therapie und Beratung ganz hautnah in Theorie, vor allem aber in gelebter Praxis mitmachen zu dürfen. Zunächst durch die weltweit intensive Vernetzung, betrieben von Helm Stierlin, und später dann durch unsere gemeinsamen Aktivitäten als Heidelberger Gruppe hatten wir die in dieser Zeit einmalige Situation, dass praktisch alle international wichtigen und führenden Vertreter und Vertreterinnen der Familientherapie und der systemischen Konzeptionen zu uns nach Heidelberg kamen und wir voneinander lernen konnten. Ich selbst, ursprünglich Diplomvolkswirt, hatte meinen Beruf gewechselt und noch Medizin studiert, ausschließlich deshalb, weil mich die Ansätze, Probleme nicht mehr nur aus einem „gestörten“ individuellen Prozess heraus zu erklären, sondern in einen kontextuellen Sinnzusammenhang zu stellen, ungemein faszinierten, insbesondere im Bereich der Therapie von Psychosen.
Die, geschichtlich gesehen, zeitlich aufeinander folgenden Modellvorstellungen leben nämlich mit durchaus noch recht kraftvollem Eigenleben wie verwandte, aber mutierte Spezies im Reich von Fauna und Flora unverdrossen nebeneinanderher.
Die mehr geschichtlich orientierten Mehrgenerationen-Familientherapiemodelle wie die von M. Bowen, I. Boszormenyi-Nagy, die frühen Bindungs-/Ausstoßungs-/Delegationskonzepte von Helm Stierlin oder die Vorstellungen von N. Paul (hinsichtlich unbewältigter Trauerprozesse in Familien, die zu Symptomen führen können) fordern wieder mehr die Beachtung des Kontenausgleichs der Schuld- und Verdienstkonten und die Beachtung der familiären „Vermächtnisse“ etc. Gerade diese Sichtweisen finden sich dann übrigens wieder in den Konzepten der „richtigen Ordnung“ von Bert Hellinger – allerdings oft, ohne dass dies auch genügend transparent gemacht würde, was gerade der dort so hochgehaltenen Idee, die jeweiligen Vorgänger zu würdigen, ja gar nicht entspricht.
In den Anfangsjahren unserer Heidelberger Gruppe orientierten wir uns vorrangig an diesen Mehrgenerationenkonzepten. Dementsprechend war unsere Arbeit geprägt von den Bemühungen, die ganze Familie mit mehreren Generationen in einen Diskurs des Verstehens der Familiengeschichte, der Würdigung und des Ausgleichs von Verdiensten und der Versöhnung einzuladen. Dies erfolgte in oft vielen, in relativ kurzen Abständen (ca. zwei bis drei Wochen) aufeinander folgenden Sitzungen. Die Erfolge waren teilweise beeindruckend, nicht selten bewegte sich aber auch wenig.
Dann gewannen, teilweise auch bei uns, die mehr von normativen Funktionsvorstellungen durchdrungenen Modelle mehr Einfluss, wie z. B. die der strukturalistischen Familientherapie (Minuchin), der direktiven strategischen Therapie (Haley, Madanes), die davon ausgehen, dass es grundsätzlich funktionalere Organisationsformen in Familien gibt (klare Generationsgrenzen, Vermeiden von Triangulationen etc.), für deren Umsetzung sich die Therapeuten auch engagieren sollten. Diesen Vorstellungen folgend, versuchten wir, die Familien dazu zu bewegen, wieder klare familiäre Hierarchien aufzubauen, die Kinder aus Konfliktdreiecken herauszuhalten, Generationsgrenzen zu stärken und die Eltern anzuhalten, sich auf eine gemeinsame Linie den Kindern gegenüber zu einigen. In „family lunches“ (Minuchin) mit Familien von anorektischen Mädchen z. B. versuchten wir, die Eltern dazu zu bewegen, sich so lange gemeinsam zu engagieren, bis sie die Indexpatientinnen wieder zum Essen gebracht hatten.
Die Therapeuten gerieten dadurch aber sehr stark in die Rolle der Vertreter bestimmter Normvorstellungen. Ich erlebte dies immer wieder als Gestaltung von ungleichen Beziehungen, in denen die Therapeuten auch beanspruchten, die „Wissenden“, die Experten zu sein, die besser als die Familien selbst wussten, was für diese gut sei und was sie deshalb auch gefälligst zu machen hätten. Mit dieser Rolle fühlte ich mich überhaupt nicht wohl. Immer hatte ich den Eindruck, dass ein solches Vorgehen der Einzigartigkeit und den (kontextbezogen sehr unterschiedlichen) Bedürfnissen und Aufträgen der jeweiligen Familien einfach nicht genug dient. Die Maxime, an der ich mein Handeln ausrichten wollte (dies gilt, noch viel konsequenter als damals, auch heute) war: „Gehe mit Menschen so um, wie du selbst gerne hättest, dass man mit dir umgeht, insbesondere dann, wenn du auf das Wohlwollen anderer angewiesen bist.“ Unseren Umgang mit den Klienten und ihren Familien erlebte ich, obwohl sehr gut gemeint, häufig aufgrund dieser Expertenposition ihnen gegenüber als nicht dieser Maxime entsprechend.
In den systemisch-konstruktivistischen Therapie- und Beratungsmodellen, die wir seit ca. 1977 in engem Austausch mit der Mailänder Gruppe (Selvini, Boscolo, Cecchin, Prata) zum zentralen Modell unserer Arbeit machten (die als der Ansatz der Neuen Heidelberger Gruppe bekannt wurde), wurde dann immer konsequenter davon ausgegangen, dass man keineswegs unbedingt z. B. die Geschichte (weder die individuelle noch die familiäre) ganz „verstehen“ oder „aufarbeiten“ müsse oder in so massiver