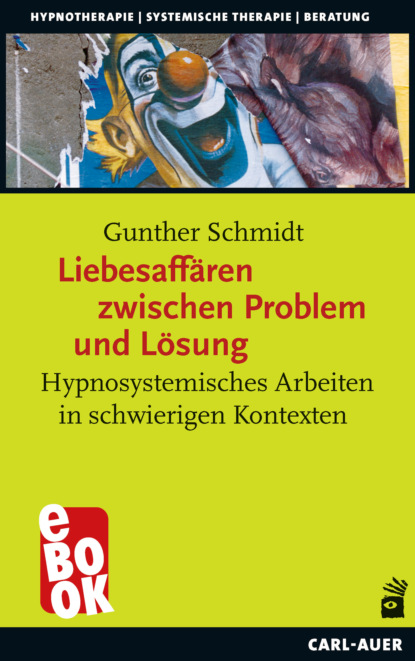zwischen den Generationen, klarer Kommunikation etc. wichtige Orientierungspunkte. Auch die späteren Entwicklungen in der Arbeit von Mara Selvini Palazzoli weisen noch in diese Richtung, wenn sie konsequent immer wieder die „ubiquitäre Verschreibung“ anbot, mit der z. B. Eltern dazu gebracht werden sollten, eine klare Grenze zu anderen Subsystemen in der Familie aufzubauen.
Zentrale Basis der Arbeit war aber die Sicht (da alles Erleben, auch Probleme, als Ausdruck von Mustern angesehen wird), dass allgemein Veränderung jeweils dadurch passiert, dass Unterschiede in bisherige Muster (Vernetzungen) eingeführt werden. Wo und wie diese Unterschiede gebildet und in die Organisation des Systems implementiert werden können, ist dabei noch nicht spezifisch eingegrenzt, die Unterschiede sollten nur bedeutsam sein („Unterschiede, die einen Unterschied machen“), könnten sich aber z. B. darauf beziehen, dass ein bestimmtes Verhalten geändert wird, Bewertungen oder Beschreibungen von Phänomenen (wie z. B. von „Krankheiten“) verändert werden, Abläufe zeitlich oder örtlich verändert werden etc.
Auch in diesem Vorgehen war die Art, wie die Gespräche gestaltet und Interventionen gebildet wurden, dabei natürlich sehr geprägt davon, wie man sich die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Symptomen vorstellte. Als vorrangig wurde damals angesehen, dass lebende Systeme, um ihr Überleben zu sichern, vor allem versuchen, ihre Homöostase aufrechtzuerhalten und alle Abweichungen davon durch (negatives) Feedback wieder auf den Ausgangswert zu bringen (der Aspekt der Morphogenese war noch nicht genug als bedeutsam berücksichtigt). Und: Wenn diese Homöostase durch irgendwelche Ereignisse stark gestört wird, kann dies bei Beteiligten im System massiven Stress auslösen, der z. B. auch zu Symptomen führen kann. Diese Symptome wiederum wirken aber wie ein Feedback im System auf seine Organisation ein, sehr oft sogar so, dass sie zur alten Homöostase zurückführen. Wenn z. B. in einer Familie die Eltern auseinander streben und von Familienmitgliedern die Gefahr einer Trennung empfunden wird und gerade in dieser Phase eine adoleszente Tochter mit einem Hungerstreik beginnt, der dann als Anorexie diagnostiziert wird, kann dies als so gefährliche Notsituation in der Familie erlebt werden, dass alle zentripetalen Bewegungen gebremst werden, die den Familienbestand gefährden könnten. Um der Gefahr zu begegnen, kann die Familie als „Notgemeinschaft“ wieder zu mehr Kohäsion finden, können die alten Bindungskräfte wieder aktiviert werden, kann das System sich wieder stabilisieren, nun aber mit Einbau des Problems „Anorexie“.
Diese Sicht führte uns dazu, dem Symptom intensiv zuzuschreiben, es habe jeweils eine homöostatische Funktion in der und für die Familie. Daraus wieder wurde geschlossen, dass dann die Aufträge, welche uns die Familien gaben, mit großer Wahrscheinlichkeit äußerst widersprüchlich, ja paradox seien, z. B. in der Art: „Helft uns schnell, die Symptome zu ändern und aufzulösen, wagt es aber ja nicht, dies zu tun, denn dies würde unsere Homöostase gefährden.“ Die Aufträge wurden als Doublebind (Zwickmühle) empfunden, das nur dadurch wieder aufgelöst werden konnte, dass die Therapeuten selbst noch geschickter als die Familien paradox vorgingen (dementsprechend lautete auch der Titel des damals als Pionierwerk angesehenen Buches der Mailänder Gruppe: Paradoxon und Gegenparadoxon). „Paradoxe Interventionen“ waren z. B. Vorschläge an die Klienten, gezielt das für eine umschriebene Zeit zu machen, was sie als Ziel der Therapie gerade auflösen wollten (z. B.: „Wir finden, dass es noch zu früh ist, die Symptome jetzt schon abzulösen. Damit Sie die Zusammenhänge besser verstehen können, die bisher zu diesen qualvollen Depressionen beigetragen haben, möchten wir Sie bitten, jeden Abend von 18 bis 19 Uhr sich darauf zu konzentrieren, in dieser Zeit besonders depressiv zu sein und dabei alle Gedanken und sonstigen Prozesse, die dazu beitragen können, genau zu registrieren“). Diese auch als „Symptomverschreibung“ bekannten Interventionen sollten die bisherige Organisation des Systems unterbrechen, bisherige Lösungsversuche bremsen und neue Strategien anregen, oft auch um den Widerstand der Klienten und ihrer Familien gegen Veränderung zu unterlaufen und zum Gegenteil zu provozieren.
Diese Perspektive führte fast zwangsläufig dazu, dass wir systemischen Therapeuten aus meiner Sicht praktisch alle in eine milde paranoide Haltung den Familien gegenüber gerieten. Die Interviews und Interventionen wurden aus einer strategisch-distanzierten Haltung zum Teil mit elaborierter Raffinesse gestaltet. Wir führten die Interviews strikt nach unseren Vorstellungen. Die Gespräche waren wie ein Ritual aufgebaut: a) Zunächst wurden schon vor der Sitzung von den Therapeutenteams Hypothesen darüber gebildet, welche Muster in den Familien wahrscheinlich das Problem aufrechterhalten könnten (bei uns waren es üblicherweise vier Therapeuten, zwei, die das Interview führten, und zwei Beobachter hinter der Einwegscheibe); dann folgte b) das Interview selbst (ca. 90 Minuten), in dem die Therapeuten, abgeleitet aus diesen Hypothesen, viele zirkuläre Fragen stellten als Instrument dafür, möglichst viele Informationen über die problemerhaltenden Muster zu gewinnen; daran schloss sich c) die Beratung zusammen mit den Beobachtern an. Hierbei wurden die gewonnenen Informationen als Grundlage genutzt für die Beschreibung von Mustern, die wir als problemstabilisierend ansahen. Daraus wurden dann die Interventionen abgeleitet, die (z. B. als positive Umdeutungen von bisher als „krankhaft“ angesehenen Phänomenen oder als „paradoxe Intervention“) bewirken sollten, dass die Familien sich in hilfreicher Weise neu organisierten. Diese Interventionen wurden dann d) durch die Interviewer als Schlusskommentar an die Familien übermittelt. Dabei wurde sehr darauf geachtet, nur diesen Kommentar zu geben und dann keinesfalls noch weiter mit den Familien zu reden, aus der Befürchtung heraus, dies könne die Wirkung der Interventionen behindern.
Den Familien wurde nicht transparent erläutert, welche Hypothesen wir jeweils hatten und welche Absichten wir mit den Interventionen verbanden. Das wurde schon deshalb als sehr wichtig angesehen, weil wir ja davon ausgingen, die Familien würden jede transparente Information über unser Vorgehen und überhaupt jede ausführlicher Konversation über die zirkuläre Befragung und den Schlussinterventionskommentar hinaus sofort mit Gegenregulation zur Wiederherstellung der alten Homöostase (und damit zur Restabilisierung der Symptome) beantworten.
Ich erinnere mich an eine mich sehr beeindruckende Situation, als Mara Selvini Palazzoli wieder einmal in Heidelberg bei uns zu Besuch war (in der Abteilung für Familientherapie, deren Leitung Helm Stierlin innehatte). Sie beklagte sich dabei einmal, es sei in den letzten Jahren immer schwieriger geworden mit ihrer Arbeit, da sie so bekannt und erfolgreich geworden sei. Es käme jetzt öfter vor, dass Familien schon ganz gelassen kommentieren würden: „Aha, Sie machen jetzt wohl eine paradoxe Intervention mit uns, so wie Sie das in ihrem Buch beschreiben …“ Ich fragte mich dabei, was es eigentlich für eine merkwürdige Konzeption ist, wenn Menschen Angebote für die Gestaltung ihres Lebens bekommen und man dabei davon ausgeht, sie dürften nicht vollständig eingeweiht sein in das, worum es da geht, die Anbieter der Intervention aber sehr wohl. Diese Aspekte von asymmetrischer Beziehungsgestaltung kamen mir überheblich und letztlich die Klienten abwertend vor. Für mich war zweifelsfrei klar, dass ich selbst so nicht behandelt werden wollte und sicher auch mit großem Widerstand auf solche Angebote reagiert hätte. Und auch wenn wir damit oft erstaunliche, ja spektakulär anmutende Erfolge (i. S. von Symptomverbesserungen oder -auflösungen) erzielen konnten, hatte ich den Eindruck, dass wir weit unter den Möglichkeiten blieben, die ich in dem Grundmodell einer systemisch-konstruktivistischen Konzeption angelegt sah.
Ein aus meiner Sicht schwer wiegendes Manko unserer (damals meist noch so häufig als möglich die Familie von Indexklienten einbeziehender) Arbeit war auch, dass entgegen unserer Absicht sehr häufig die Kooperation mit uns von den beteiligten Klientensystemen als ein deutlicher Hinweis darauf erlebt wurde, dass die Familie wahrscheinlich doch in erheblichem Maß ein wichtiger Problemkontext sei, dass quasi die Familie ein „Herd der Störung“ sei (entsprechend der Idee „Patient Familie“ von H. E. Richter). So wurden viele Therapien von den Beteiligten im Familiensystem eher als Tribunal denn als wertschätzende Hilfe erlebt. Das wollten wir zwar nicht, aber gemäß unserer eigenen Konzepte mussten wir zerknirscht einräumen, dass die Bedeutung einer Botschaft eben immer die Empfänger und nicht die Sender der Botschaft bestimmen. Ebenso sehr missfiel mir, dass aufgrund der Prämissen, an denen wir uns orientierten, letztlich die Familien als sehr defizitär beschrieben wurden. Gleichzeitig gingen wir ja aber davon aus, dass unsere Interventionen die Familien anregen könnten, in Selbstorganisation hilfreiche Entwicklungen zu gestalten. Ohne diese Annahme wären unsere Interventionen weder logisch noch ethisch haltbar gewesen. Wenn Familien,