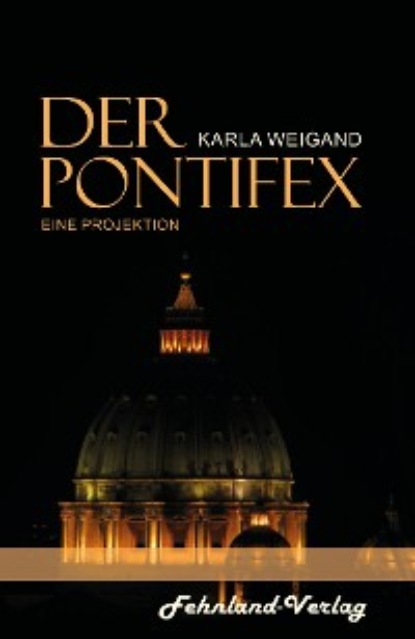hat.
„Nur kein Neid, chers amis! Ohne Zweifel schaut der Bursche ganz gut aus und hätte nach meinem Empfinden zweifellos besser daran getan, Filmstar anstatt ausgerechnet Priester zu werden.“
„Und gar noch mit dem nicht gerade demütigen Anspruch, es irgendwann ‚ganz nach oben’ zu schaffen. Schon als junger Kaplan in Ostafrika hat er verbreiten lassen, er sehe sich schon mit Mitra und Bischofsstab!“
Letzteres, wiederum von dem flämischen Miesepeter geäußert, ist zwar eine glatte Verleumdung – tatsächlich waren es etliche aus Obembes familiärem Umfeld, die sich vor Jahrzehnten in diesem Sinne geäußert haben. Aber um solche Feinheiten schert sich keiner der Anwesenden und so widerspricht auch niemand.
„Vor vier Jahren zum Kardinal ernannt, scharrte er seitdem mit den Hufen“, fährt der Geistliche aus dem westflandrischen Brügge mit Ingrimm fort. „Wie man sieht, hat sich diese Beharrlichkeit ausgezahlt.“
„Wir tragen selbst die Schuld daran, chers amis, dass wir es dem afrikanischen Schönling ermöglicht haben, die klerikale Hierarchie im Sturmschritt zu erobern, alle zu düpieren und die Karriereleiter in Rom ungebremst nach oben zu klettern!“
Dieses Statement des Franzosen aus der Picardie, der gerade eins der delikaten Kaviarhäppchen zum Munde führt, setzt quasi den Schlusspunkt dieser Debatte; er erntet auch keinen nennenswerten Widerspruch: Man hätte dem Afrikaner nur rechtzeitig seine Grenzen aufzeigen sollen …
Ausgerechnet von Kurienkardinal Ettore di Logelli-Branca stammt dann völlig überraschend ein zwar bitteres, aber sehr vernünftiges Fazit.
„So sollten wir uns demnach klugerweise mit der Katastrophe arrangieren! Was bleibt uns denn auch anderes übrig? Haben wir etwa eine andere Option? Wir können schlecht eine Kirchenspaltung durch die erneute Wahl eines uns genehmen Kandidaten riskieren. Die Zeiten, in denen Gegenpäpste gang und gäbe waren, sind lange vorbei. Und den Gefallen, alsbald zu unserem Herrn einzugehen, den wird er uns kaum tun.“
Beifälliges Gemurmel der meisten ist die Folge. Jeder muss eben einen Kompromiss finden und sich ins Unvermeidliche fügen; soll heißen, gute Miene zum bösen Spiel machen – und dabei insgeheim indirekten Widerstand leisten, wo immer möglich.
„Dann, geliebte Brüder in Christo, lasst uns also gemeinsam beten für Leo und unsere heilige Mutter Kirche – und darauf hoffen, dass nach dem Mann aus dem Busch wieder einer ans Ruder kommt, mit dem wir uns alle identifizieren können!“
Zu diesem Vorschlag des Kardinals macht keiner der Anwesenden einen Einwand geltend. „Amen, so sei es, lieber Freund!“ „Amen, mon ami!“ „Amen, my dear friend!“ „Lasset uns beten, amigos mios!“ „Nun denn: Orate, fratres!“
Und das tun die Herren aus dem alten Europa und aus Amerika dann auch. Ob sie dabei allerdings ihrem obersten irdischen Chef im Vatikan auch ein langes Leben wünschen, oder vielleicht etwas ganz anderes – das wird für immer ihr gut gehütetes Geheimnis bleiben.
GLORIA
„In excelsis Deo!“
Elisa Obembes spektakuläre Flucht ist nach ihrer Ankunft bei den Benediktiner Missionspatres zu Ende.
Zu erschöpft sind sie und die übrigen, die mit ihr den Gang ins Ungewisse gewagt haben, als dass sie danach streben würden, sich erneut den Gefahren eines Eintauchens in den gefährlichen Dschungel, der Überwindung steiler Berge und unfruchtbarer Wüstenstreifen und des Durchquerens krokodilverseuchter Flüsse auszusetzen und sich dabei auf das Risiko einzulassen, von der deutschen Kolonialmacht unerbittlich gejagt – und letztendlich doch zur Strecke gebracht zu werden.
Nach nur wenigen Tagen ist Elisa sicher, bei den frommen Mönchen für sich und ihre Kinder ein neues Zuhause gefunden zu haben. Dazu hat es lediglich mehrerer ausführlicher Gespräche mit dem Prior des Klosters, Pater Hilarius Hilreiner, bedurft, der ihr ein gerechter und kluger Mann zu sein scheint. Für sie ein echtes Wunder: gehört er doch der Rasse der Weißen an …
So kommt es auch den meisten anderen Flüchtigen vor. Alle, bis auf zwei jüngere Frauen ohne Kinder, wollen bleiben, künftig für die Mönche arbeiten und im Tausch dafür deren Schutz genießen.
Die meisten sind bereits getauft, bis auf ein paar ältere Wahehe-Frauen, die der Christianisierung bisher entkommen sind. Aber auch sie sind zur Taufe bereit, falls man ihnen im Gegenzug Nahrung und Obdach bis ans Ende ihrer Tage gewährt.
‚Alle scheinen zufrieden mit ihrem Schicksal’, muss der kleine Maurice erkennen, Elisas ältester Sohn. Er selbst ist unglücklich und zornig darüber, künftig bei den „heiligen Vätern“ der verhassten Eroberer-Rasse leben – und noch dankbar dafür sein zu müssen.
Obwohl satt und sicher, mit einem Dach über dem Kopf und einer Mutter, die zwar fleißig ist, aber keineswegs ausgebeutet wird, und obgleich er wie die anderen Kinder fast nichts arbeiten muss und stattdessen beinah den ganzen Tag spielend verbringen darf, ist der sechsjährige Häuptlingssohn fest entschlossen, unzufrieden und voller Groll zu sein.
Vor allem Letzteres liegt ihm sehr am Herzen: Jeden Tag ruft er sich erneut die Schandtaten jener deutschen „Herren“ ins Gedächtnis, von denen er in seinem bisherigen kurzen Leben erfahren hat.
Nein, mit den Feinden aus dem fernen Norden wird Maurice sich niemals anfreunden; und dazu zählen für ihn auch die humanen und freundlichen Klosterbrüder. Er versteht weder seine über alles geliebte Mutter, noch die anderen „Sklaven“, die nach einiger Zeit gewissenhafter Pflichterfüllung vom Vater Prior offiziell freigelassen werden und wählen dürfen, wohin sie gehen wollen. Niemand verlässt das Kloster. Auch die beiden Kinderlosen haben sich mittlerweile fürs Bleiben entschieden.
Jeden Tag redet Elisa ihrem Ältesten gut zu; aber trotzig verharrt der kleine Junge in seiner ablehnenden Haltung.
„Mutter, du selbst hast mich doch geheißen, niemals das Unrecht der weißen Eroberer zu vergessen! Du hast mir auch das Versprechen abgenommen, mich einst zu rächen für die Ermordung meines Vaters Mkwa, des tapferen Häuptlings der Wahehe.
Warum findest du es jetzt in Ordnung, dich mit den Weißen zu verbrüdern? Nur weil die Mönche uns nicht wie Tiere behandeln? Das wäre auch sehr merkwürdig, wo sie doch immer von der Liebe zum Nächsten faseln!“
Elisa vermag den Jungen nicht umzustimmen. Vorerst noch nicht. Sie wird ihn nicht zwingen, sondern abwarten, was die Zukunft bringt; hoffentlich Vernunft und Frieden und Freiheit für ihr Volk. Dass sie insgeheim ähnlich wie ihr Sohn empfindet und seine Gefühle nur zu gut versteht, aber klug zu verbergen weiß, darüber schweigt die stolze Frau. Maurices Mutter Elisa hat sich, der Not gehorchend, wie die meisten ihrer Landsleute mit ihren Feinden, den weißen Okkupanten, abgefunden und bestens arrangiert.
Wohin sollte sie auch gehen? Ihr früheres Dorf haben die deutschen „Schutztruppen“ dem Erdboden gleichgemacht, die Einwohner gefangengenommen und an deutsche Plantagenbesitzer als Arbeitssklaven verteilt. Immerhin werden sie von den Patres ungleich besser behandelt als von den europäischen Pflanzern.
Sie müssen zwar tüchtig arbeiten, sind in ihrem eigenen Land im Grunde unfrei, weil außerhalb des Klosterareals nur brutale Unterdrückung herrscht, aber sie brauchen nicht um ihr Leben zu fürchten, werden anständig ernährt und im Krankheitsfalle nicht davongejagt, sondern medizinisch versorgt, erhalten bis zum Tod ihr Gnadenbrot, um nach ihrem Ableben nicht im Urwald verscharrt, sondern ehrenvoll im Beisein eines Priesters auf dem Klosterfriedhof begraben zu werden.
Die deutschen Missionsschulen in Deutsch-Ostafrika haben zudem das wichtige Bildungsmonopol inne. Das allein gab für Elisa schon den Ausschlag: Bildung für ihre Söhne hat sie sich immer gewünscht!
Bald besucht auch Maurice auf Elisas Drängen hin die Schule der Benediktinermönche. Es gibt kaum staatliche Schulen und die wenigen sind nur im Bereich der Küste des Indischen Ozeans angesiedelt, wo das feuchtschwüle Klima Ungeziefer aller Art gedeihen lässt und selbst für die Einheimischen höchst ungesund und kaum zu ertragen ist.
Zu Beginn versucht Maurice,