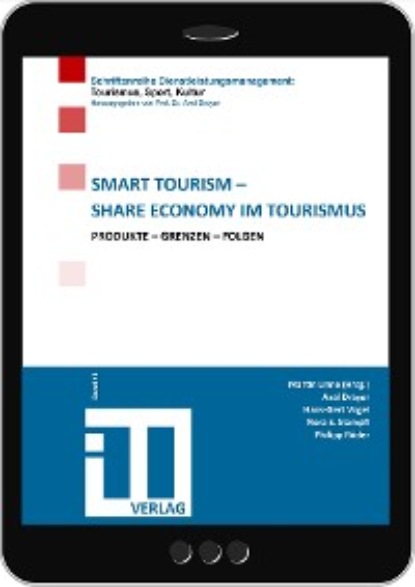das Internet kein „Lesemedium“ mehr, das Mitmachen steht im Vordergrund. Die Nutzung von Wikis, Blogs und sozialen Netzwerken führt zu einer neuen Kultur des Informationsaustausches. Weil die sozialen Medien neue Formen der Interaktion und Vernetzung ermöglichen, lassen sich Menschen immer weniger einfach „berieseln“, sondern greifen aktiv in Informationsprozesse ein und gestalten diese mit. Dabei bleibt unser Leben inmitten einer Flut von peer-to-peer Netzwerken und Echtzeit-Technologien nicht ohne Auswirkungen auf unser Sozialverhalten. Insbesondere die junge Generation, die mit dem digitalen Reich aufgewachsen ist und die Suche im Netz wie ihre Muttersprache beherrscht, ganz selbstverständlich chattet, twittert, bloggt und postet, unterscheidet kaum noch zwischen virtueller und realer Welt. Denn das Internet ist seinen Ureinwohnern weit mehr als Kommunikationsmittel, es ist Kulturraum und gelebte Realität. Ging es im alten Web 1.0 um den Zugang zu Information, so dreht sich im Web 2.0 alles um den Austausch – und zwar nicht nur von Information, sondern ebenso von Musik, Software, Videos, Unterhaltung. Daher überrascht es nicht, dass virtuelles Teilen und Tauschen immer selbstverständlicher wird und sich mit den verschwimmenden Grenzen zwischen on- und offline auch auf die reale Welt ausdehnt. Die im Netz gelebten Verhaltensweisen setzen sich im echten Leben fort, weswegen immer öfter reale Dinge mit einem größeren Personenkreis geteilt werden als dies bisher üblich war.
Der vernetzte Konsument
Durch die Vernetzung kommt es zu einer Neudefinition dessen, was Freundschaft und Familie und das Eingebundensein in Gemeinschaften bedeuten. Dies erstreckt sich auch auf neue Formen der Gemeinschaft: Denn das soziale Leben spielt sich mehr und mehr auch im Internet ab. Soziale Netzwerke sind der erweiterte Lebensraum. Die Werkzeuge der digitalen Welt konfigurieren das Verhältnis zwischen „Ich“ und „Wir“ neu. Seit Anbeginn stand das Internet in dem Ruf, zur Vereinzelung und Isolierung von Menschen beizutragen sowie der „Bowling Alone“-These des US-amerikanischen Soziologen Robert D. Putnam1 in die Hände zu spielen, indem es traditionelle Gemeinschaften aushöhle. Doch davon kann keine Rede sein: Die modernen Vernetzungstechnologien führen lediglich dazu, dass Menschen die Art und Weise ändern, wie sie miteinander interagieren. Die Vernetzung wird von Rainie und Wellman2 gar als neues Betriebssystem der Gesellschaft gesehen: Mit dem „vernetzten Individualismus“ („networked individualism“)3 bilde sich eine Lebensform heraus, die den Menschen aus seinen traditionellen sozialen Gruppen herauslöst. Heute haben Individuen ein größeres Maß an Freiheit gegenüber den verschiedenen sozialen Strukturen, denen sie angehören, sie sind weniger abhängig von Familie, engen Freunden, Kollegen oder Nachbarn. Stattdessen sind sie hoch vernetzt und organisieren sich ihre sozialen Beziehungen selbst. Vor allem durch eine große Zahl schwacher Bindungen sind die vernetzten Individualisten im Austausch mit vielen Menschen. Damit verliert die Zugehörigkeit zu den traditionellen sozialen Gruppen an Bedeutung gegenüber der Beteiligung an unterschiedlichen, stärker fragmentierten, selbst gewählten und frei verhandelbaren Netzwerken, die Beistand gewähren, wann dieser gerade benötigt wird. Die festen Bindungen weichen „on-demand“-Beziehungen. Die ehemals festgefügten Trennlinien zwischen Freunden und Fremden bröckeln und leisten gemeinschaftlichem Konsum Vorschub. Denn peer-to-peer Konsum erfüllt das Verlangen nach Zugehörigkeit zu solch lockeren Gemeinschaften. Ironischerweise fördert das Internet somit die Zusammengehörigkeit im „echten“ Leben. Die Transaktionen werden zwar im Netz angebahnt, aber immer geht es dabei auch um das Kennenlernen anderer Menschen; Zweck ist nicht der unpersönliche Austausch, sondern eine Erfahrung unter Gleichgesinnten.
Gemeinschaft neu definiert
Die Lebensform des vernetzten Individualismus schreibt Gemeinschaft groß – auch wenn sich die modernen Gemeinschaften durchaus von jenen früherer Zeiten unterscheiden. Denn man wächst nicht mehr in sie hinein, sondern vernetzt sich je nach Interessen, Bedürfnissen und beruflichen Belangen. Im 21. Jahrhundert gehören Individualismus und Kollektivismus zusammen, Gemeinsinn gibt es nicht ohne Eigensinn: Es ist eine kalkulierte Suche nach Gemeinschaft, das „Ich“ bleibt im „Wir“ bestehen. Der Mensch der modernen Netzwerkgesellschaft folgt der Einsicht, dass es für den Einzelnen oftmals am nützlichsten ist, Dinge zu tun, die auch für andere nützlich sind. Dem eigenen Ziel kommt man in vielen Fällen nur näher, wenn auch andere vorankommen. Je mehr sich beteiligen, desto mehr erreicht man für sich. Dieser Blick auf Gemeinschaften beschreibt den Kern einer wesentlichen Voraussetzung der Share Economy: Teilen, Tauschen und sonstige Formen gemeinschaftlichen Konsums werden sich immer dort herausbilden, wo eine kritische Masse gegeben ist, die einen ausreichend großen Pool an Wünschen und Angeboten vereint. Mit jedem weiteren Mitglied steigt der Nutzen für jeden einzelnen Teilnehmer.
Dabei sind die Zusammenschlüsse im Web bei weitem nicht so opportunistisch und pragmatisch wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen, ihm sind die Gemeinschaften im Internet weit mehr als bloß Mittel zum Zweck. Es lässt sich beobachten, dass in online Communitys mitunter ein echtes Wir-Gefühl entsteht sowie sämtliche Begleiterscheinungen auftreten, wie man sie auch von herkömmlichen sozialen Gruppierungen kennt: vom Auge-aufeinander-Haben bis zum Stalking, von der Ausbildung eines familiären Gefüges bis zur Nutzung als Bühne zur Selbstdarstellung. Und somit bieten virtuelle Netzwerke heute das größere Ganze, nach dem der Mensch in der individualisierten Welt sucht. Der Fokus moderner Gesellschaften auf das Individuum hat zu Gefühlen der Entfremdung geführt und den Wunsch bestärkt, Teil eines wichtigeren, über den eigenen Horizont hinaus reichenden und mit anderen geteilten Anliegens zu werden. Das Verlangen nach Zugehörigkeit und Beteiligung ist getrieben von der Suche nach Verbundenheit, nach einem Zweck und einer Rolle, die über die Trivialitäten des Alltags hinausreichen. Beim Konsumieren wird das „Ich“ immer öfter durch ein „Wir“ abgelöst: Die Share Economy beruht daher auch auf dem Gedanken, nicht nur eine streng abgegrenzte Leistung zu vermitteln, sondern immer geht es beim Sharing auch darum, Anschluss an eine Gemeinschaft zu finden. Der Glaube an das Gemeinsame und dadurch Teil eines größeren Ganzen zu werden sind wichtige Bestandteile aller Sharing-Plattformen. Es geht um viel mehr als nur den Austausch von Werkzeugen, die gemeinsame Nutzung von Büros, das Übernachten auf einem fremden Sofa, schlicht weil es billiger kommt als die Anschaffung des eigenen Werkzeugkastens, Miete spart und man sich das Hotel nicht leisten kann. Leute kaufen sich in eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten ein, es geht ihnen nicht nur darum, Zugang zum Nutzen eines Produkts zu erhalten, sondern auch zu Menschen. Letztlich verspricht Sharing eine reichere Erfahrung als lediglich ein Produkt zu konsumieren.
Konsum 2.0: vom Selbstwert zum Gemeinschaftswert
Während die Marken des 20. Jahrhunderts rund um Selbstwertgefühl und die Schaffung einer Identität kreisten, basieren die Marken des 21. Jahrhunderts auf Beziehungen und Teilhabe. Konsumenten geht es heute immer auch darum, ein soziales „Selbst“ zu kreieren und sind daher auf der Suche nach Verbindungen zu anderen und Zugehörigkeit zu Gemeinschaften. Menschen definieren sich nicht mehr nur über den Kauf bestimmter Produkte und das Zurschaustellen von Markenzeichen. Identität entsteht heute, indem wir zeigen, welchen Gruppen wir uns zugehörig fühlen (Xing, LinkedIn), was wir tun (Twitter), wer unsere Freunde sind (Facebook), was uns gefällt (Pinterest) und wofür wir uns interessieren (Digg, Delicious). In unserem vernetzten Zeitalter erfolgt daher auch Konsum immer öfter durch Aushandlung mit anderen.
2.2 ZUGANG STATT EIGENTUM: MATERIELLER WOHLSTAND IST NICHT GENUG
Wir stehen am Rande einer neuen Ära, in der die Nutzung von Dingen wichtiger wird als deren Eigentum, die Anhäufung von immer mehr Besitz wird verdrängt vom Wunsch, bloß Zugang zu diesen Dingen zu erhalten. Konsumenten werden zu Nutzern, Leihern und Mietern. Kunden suchen nach einem Nutzen, einem Erlebnis oder einer Erfahrung, nicht primär nach einem Produkt: Denn es geht nicht um den Rasenmäher, sondern den gemähten Rasen, nicht um den Hammer, sondern den Nagel in der Wand.
Der US-amerikanische Ökonom und Publizist Jeremy Rifkin1 hielt schon Ende des letzten Jahrhunderts die Idee, Dinge zu kaufen und sie zu besitzen für überkommen. Immer häufiger werden wir nicht mehr Eigentum, sondern Nutzungsrechte erwerben, ein „just-in-time“-Zugang