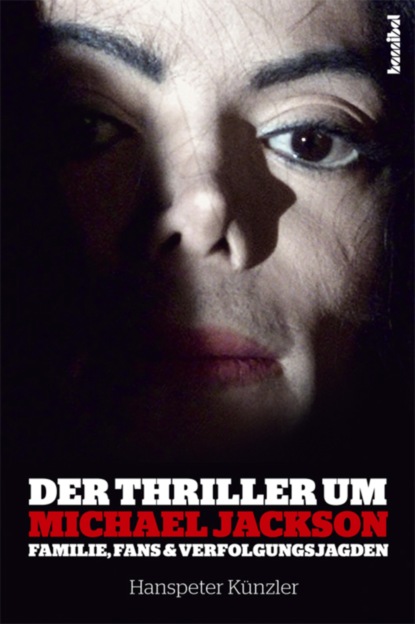von Vater Joseph Jackson, der den Sologelüsten von Michael mit Misstrauen gegenüberstand. Er befürchtete – zu Recht, wie es sich herausstellte –, dass ein möglicherweise eintretender Soloerfolg einen Graben zwischen Michael und seinen Brüdern aufreißen würde. Bestimmt auch wusste er, dass es die weiterhin von ihm gemanagten, mit solidem, aber nicht blendendem Talent ausgerüsteten Rest-Jacksons schwer haben würden, ohne den Talisman Michael noch Gehör zu finden.
„Off the Wall“ hielt sich sechzehn Wochen lang an der Spitze der amerikanischen „Black Music“-Charts und erreichte in den dortigen Pop-Charts Rang drei. Damit war Michael Jackson nicht nur in der amerikanischen Soul- und Funkszene als Solokünstler etabliert (der Ausdruck R&B war damals noch für den jazzig angehauchten Gospel-Blues eines Ray Charles oder Fats Domino reserviert), sondern auch in Großbritannien, Frankreich, Brasilien und Australien. Die langjährigen Fans von Soul und Funk nach angestammtem „funky“ Muster hatten Mühe, sich mit dem für ihren Geschmack zu glattpolierten Album anzufreunden. „Wer braucht schon einen einzelnen Jackson im Haus, wenn er auch die ganze Familie haben könnte?“, fragte giftig die englische „Black Music & Jazz Review“. Aber bei der nächsten Generation von Musikfans schlug das Album ein wie eine Bombe. Die elastische und subtil unterspielte Mélange aus Funk, Disco, Soul, Jazz und Pop, ganz zu schweigen von der androgynen Stimme, war neu.
In den USA hatte die Disco-Welle den Graben zwischen „schwarzer“ und „weißer“ Musikkultur, der sich nach dem Verblassen des rassenblinden Motown-Sounds der Sixties nur noch breiter aufgetan hatte, zwischenzeitlich zugeschüttet. Da passte „Off the Wall“ eh perfekt ins Klima. In Großbritannien, wohl auch in Frankreich, sprach das Album der Jugend aus dem Mund, auch wenn es für den amerikanischen Markt konzipiert worden war. Die erste Generation von Secondos – Kinder von Immigranten aus Jamaika und vom indischen Subkontinent – hatte in den Schulen die Oberstufe erreicht. In den urbanen Schulen waren die Klassen kulturell durchmischt wie noch nie. Ungeachtet der Hautfarbe der Schüler und der Musik, welche deren Eltern daheim erklingen ließen, waren diese nicht entweder mit Pop, Rock, Soul, Reggae oder Afrobeat aufgewachsen, sondern mit all diesen Musikformen zusammen. Es konnte durchaus sein, dass sie selbst auf Chic standen und Queen und Bob Marley grässlich fanden – aber ob sie es wollten oder nicht, auch Queen und Bob Marley gehörten zur Klangkulisse ihres Aufwachsens. Eine Popmusik, die ihnen aus dem Herzen sprach, musste denn zumindest die Möglichkeit offenlassen, dass Spurenelemente all dieser anderen Musikstile darin zu orten waren. In einer Zeit, in der besonders die jungen britischen Reggae-Bands arg dagegen anzukämpfen hatten, dass Reggae mit Einflüssen, die nicht aus dem Ghetto von Kingston kamen, weit herum als „unauthentisch“ oder gar „verweichlicht“ abgetan wurde, setzte „Off the Wall“ ein kühnes Zeichen: Das Album zeigte, dass es möglich war, das Stildiktat festgefahrener Genre-Konventionen zu ignorieren und gerade dank einer Stilsynthese aus dem Reagenzglas des Studios zu einer neuen Authentizität durchzufinden. Vor kurzem wurde der erfolgreiche New Yorker Rapper und Business-Kapitän Jay-Z (Jahrgang 1969) gefragt, welches sein Lieblingsalbum von Michael Jackson sei. Er nannte „Off the Wall“: „Es ist zeitlos, es passt in kein Genre, es hat keine Hautfarbe. Ob man es genießen kann, hängt nicht vom Alter ab. Meine Mutter hat es gehört, ich habe es gehört. Und trotzdem war es einfach cool.“
Nur ein einziger Fan aus dem deutschen Sprachraum hat im Gespräch oder auf dem Fragebogen „Off the Wall“ – wie ich es getan hätte – als Ausgangspunkt seines Fan-Seins angegeben. „Bad“ entpuppt sich als das Album, das die meisten neuen Fans anlockte, gefolgt von „Thriller“ und „Dangerous“. 5 Prozent gaben gar an, erst mit seinem Tod auf die Freuden von Michael Jacksons Muse gestoßen zu sein. Einige wurden durch das Fernsehgespräch mit Oprah Winfrey oder gar durch das Interview mit Diane Sawyer an der Seite seiner kurzzeitigen Ehefrau Lisa Marie Presley auf ihn aufmerksam. Es gibt Bewunderer, die sich vor lauter Ungerechtigkeitsgefühl anlässlich der Kindsmissbrauchsanschuldigungen von 1993 oder gar 2003 zum Fan-Sein bekannten (der Eindruck wird bestätigt vom Fanklub jackson.ch, der vor allem 1993 einen großen Zulauf neuer Mitglieder verzeichnete). Allerhand Video-Clips („Heal the World“, „Earth Song“, „Give In To Me“, „Thriller“), Konzertübertragungen und -DVDs (allen voran Bukarest) brachten ebenfalls eine beachtliche Anzahl neuer Fans ins Haus. Aber nur für einen einsamen Fan kam der große Aha-Moment mit einem Song von „Off the Wall“: „Don’t Stop Till You Get Enough“. Und kein einziges Mal wurde „Off the Wall“, das Album, mit dem Michael Jackson die höchsten musikalischen – im Gegensatz zu visuellen – Mauern niederriss, als Lieblingsalbum genannt.
Verschwindend wenige heutige Michael Jackson-Fans aus dem deutschen Sprachraum können ihre Bewunderung bis „I Want You Back“ und „ABC“ zurückverfolgen. Die meisten bleibenden Fans – auch solche, die sich vom Alter her durchaus an „I Want You Back“ zurückzuerinnern könnten, wenn ihnen das Lied je gefallen hätte – sind zwischen „Bad“ (1987) und „HIStory“ dazugestoßen. Ein Großteil von diesen wurde zuerst nicht von der Musik gepackt, sondern von einem Video-Clip, einem Tanzschritt, einer Pose oder auch nur einem Fotoporträt.
Ein Grund für diese späte Hinwendung zu Michael ist wohl im deutschen Musikgeschmack und den damit verbundenen Wertvorstellungen in den Sixties und Seventies zu suchen. Abgesehen von einigen Oasen in der Umgebung amerikanischer Armeestützpunkte stieß die schwarze amerikanische Popmusik hier weitgehend auf Unverständnis. Motown, die Hitfabrik in Detroit, die unter der kaltschnäuzigen Führung von Berry Gordy Jr. aus Elementen von Soul, Gospel, Doo Wop und Rhythm & Blues einen Pop-Sound hervorbrachte, der in den USA und in Großbritannien über die ganzen Sixties hinweg schwarze und weiße Popfans in Tanz-Ekstase versetzte, blieb hier ein Kultphänomen. In den Worten eines der befragten Fans: „Motown, das hörte hier doch keiner, mit all den Kleidern und den blöden Tänzchen war das doch Kindermusik!“
Als Motown und die Jackson 5 im Zenit ihrer Karrieren standen, wurden die deutschen Charts von deutschen Schlagern und deutschen Übersetzungen englischsprachiger Hits geprägt. Dazu kamen britische Singles, deren Ruf vorab über das populäre Radio Luxemburg und die Piratensender in der Nordsee Verbreitung fand. Die amerikanische Armee-Radiokette American Forces Network (AFN) sorgte immerhin dafür, dass das kontinentaleuropäische Publikum doch noch einen Draht – einen dünnen Draht zwar, aber immerhin – zur fernen US-Hitparade hatte. Aber in den konventionellen Medien musste die Popmusik unten durch. Es herrschte sogar ein weit verbreitetes Vorurteil gegen sie, selbst wenn es um Neuerer wie die Beatles ging. „Yeah yeah“-Musik war das klangliche Pendant zum Schundheft. Wenn sie noch halbwegs toleriert wurde, war laute Musik nach dem bürgerlichen Konsens eine adoleszente Verirrung, die sich mit der psychischen Reife in eine Vorliebe für gesittete Klassik, stramme Blasmusik oder James Last verwandeln würde. Die in dieser Haltung verwurzelte Radiopolitik hatte zur Folge, dass die Hitparade selten von Liedern beseelt wurde, die nicht in den mitteleuropäischen Mainstream passten. The Supremes („Love Child“, 1969), The Edwin Hawkins Singers („Oh Happy Day“, 1969), Otis Redding („Sittin’ on the Dock of the Bay“, 1968 – es war für Reddings Hit-Chancen von Vorteil, dass sein Flugzeug im Dezember 1967 in den Lake Monona gestürzt war und ihn an der Seite seiner Begleitgruppe Bar-Kays in den Tod gerissen hatte) und Ike & Tina Turner („Nutbush City Limits“, 1973) gehörten zu den wenigen schwarzen US-Künstlern, die es in unserer Popwelt dennoch zu Ruhm brachten. Es war nicht genug, um ein breites Publikum für die Freuden von James Brown oder gar die Jacksons zu gewinnen. In der Rockszene, die sich ernst nahm, beziehungsweise im „Underground“, hatte Motown, Soul und Funk eh einen schweren Stand. Auch hier galt Popmusik wenig. Die immer waghalsigeren Experimente der Beatles, der Rolling Stones und „progressiverer“ Bands à la Nice, Pink Floyd, Cream und The Jimi Hendrix Experience hatten mächtig den Appetit auf komplexere und ausgefallenere Rockkost angeheizt. Gerade in dieser Szene machte sich eine neue Version der alten Zweiteilung zwischen Kunstmusik und Populärmusik breit. Ketzerisch vertrat man hier die Meinung, dass Rockmusik „die neue Klassik“ sei, indem sie nämlich zu einer Erweiterung des Horizonts und zur Bereicherung des Intellekts führe. Popsongs nach dem klassischen Drei-Minuten-zwanzig-Schema galten als geistloses kommerzielles Produkt, besonders wenn man dazu auch noch tanzen konnte. Darüber hinaus waren die abenteuerlustigeren deutschen Musiker mit der eigenen Suche beschäftigt, welche sie genau in die Gegenrichtung trieb. Im Bestreben, eine neue Musik zu schaffen, die in der hiesigen Kultur und nicht