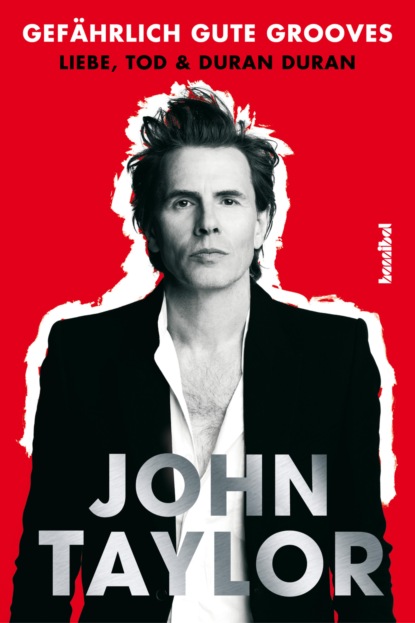ich und meine Oma, die zu Besuch war, kamen am Wohnzimmertisch zusammen, während Mum Tee, Sandwiches, Kuchen und, wenn wir Glück hatten, ihren unerreichten Trifle auftischte. Es gab in der ganzen Woche kein Ereignis, das die drei Generationen mit so viel Begeisterung zusammenbrachte wie die Top 30 Chart Show.
Eigentlich war es der Enthusiasmus von mir und meiner Mutter, der die Party zum Laufen brachte; Dad und Oma hätten ebenso gut darauf verzichten können. Aber sie schwammen mit dem Strom, und es fühlte sich zumindest so an, als würden uns die Höhen und Tiefen der Pop-Welt alle gleichermaßen erregen. Es war eine der wenigen gemeinsamen Familien-Aktivitäten.
Der Höhepunkt kam um fünf Minuten vor sieben. Dann wurde der nationale Nr.-1-Hit in voller Länge gespielt, es sei denn, der Song war so beliebt wie George Harrisons „My Sweet Lord“, der scheinbar monatelang den Spitzenplatz besetzte. In diesem Fall spielten sie bloß ein paar Takte des Songs, was ein Segen war, wenn man das Lied Woche für Woche bis zum Überdruss gehört hatte.
Mit der Zeit fiel mir auf, dass die Lieder, die ich wirklich mochte, es selten an die Spitze schafften. Meistens waren die Nr.-1-Songs etwas zu kitschig für meinen Geschmack: „Chirpy Chirpy Cheep Cheep“, „Welcome Home“ oder „I’d Like To Teach The World To Sing“. Talentshow-Gewinner oder Songs aus TV-Werbespots. Die coolen Songs schienen sich etwas außerhalb der Top 10 anzusiedeln. Wenn der Nummer-1-Hit gelaufen war, setzte Radio 1 aus, und es war Zeit für den Seewetterbericht – diese merkwürdig interessante Lektion in Sachen Wetter und europäischer Geografie. Was war Dogger Bite? Danach beanspruchten die Diensthabenden bei BBC Light Entertainment die Radiowellen wieder für Your Hundred Best Tunes mit rührseligem Zeug wie „In A Monastery Garden“ und „Songs My Mother Taught Me“. Dad machte es sich in seinem Sessel bequem, vielleicht mit einem Drink aus dem vorderen Zimmer, und Oma, die leise mitsang, nickte manchmal ein, wenn sie ein oder zwei Gläschen getrunken.
Die Simon Road 34 war ein musikalisches Haus, allerdings nicht im Sinne der Trapp-Familie. Niemand konnte auch nur eine Note spielen, und es gab im Haus kein einziges Musikinstrument. Und keiner wagte es, laut zu singen, außer Dad, wenn er blau war.
Abgesehen von Mums Transistor-Radio und Dads Stereo-Anlage gab es noch das treue, mit Eichenholz verkleidete Grammophon, das, solange ich denken konnte, im vorderen Zimmer auf dem Boden stand. Es war ein Erbstück aus Großmutters Haus. Mum und Dad benutzten es nur selten und stellten Karaffen und Whiskygläser darauf ab. Ein Bord neben dem Plattenteller war mit einer Auswahl von abgegriffenen Schellackplatten vollgestellt. Diese Überreste der Tanzmusik-Ära – Connie Francis, Frank Sinatra, Peggy Lee – waren das Spielzeug meiner Eltern gewesen und ausrangiert worden, lange bevor ich zur Welt kam.
Zwei Dinge an diesem alten Möbelstück faszinierten mich. Das war zunächst, seit ich ein Kleinkind war, der Plattenteller selbst. Es machte Spaß, ihn als Teststrecke für meine Matchbox-Autos zu benutzen. Ich hielt die kleinen Fahrzeuge so nahe an den kreisenden Filz, dass die Räder in den sich wie verrückt drehenden Belag griffen. Dabei beugte ich mich herunter, um eine Nahansicht der winzigen Reifen zu bekommen. Den visuellen Eindruck begleitete ich mit stimmlich erzeugten Sound-Effekten: der Gangschaltung und dem Brummen der Motoren.
Das zweite Element, das mich in späteren Jahren an der Musiktruhe faszinierte, war ein Röhrenempfänger, der zum Warmlaufen über eine Minute brauchte. Das Radio empfing Signale aus ganz Europa, und auf dem Frequenzband standen Orte wie Hilversum und Luxemburg, die einen exotischen Reiz ausübten. In meinen häuslichen Geografie-Stunden hatte ich vage von ihnen gehört. Der Ton schwankte, mal war er gleichmäßig und beruhigend, mal stotterte der Empfang. War das ein Spionage-Netzwerk? Ich liebte das Geräusch, wenn der Empfang schlecht war, fast genauso wie die Sendungen. Das Knistern, Ploppen und Zischen waren Töne von anderen Planeten.
Ich presste mein Ohr an den Lautsprecher und drehte, langsam wie ein Safeknacker, am Regler, in der Hoffnung, den Sender besser reinzukriegen. Es gab alle Arten von Musik; etwas Pop, häufiger aber erhebende Sinfonien und eine spröde, rhythmische Musik, bei der es sich, wie ich später erfuhr, um Jazz handelte. Fremde Sprachen schwappten in den Raum, Wetterberichte, Hochwasser und glühende Hitzewellen.
Es war, als würde das ganze Universum durch einen Trichter in das vordere Zimmer unseres Hauses gefüllt. Das war aufregend, und es ging so vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ein Zimmer, das gerade mal neun Quadratmeter maß, war zu einem Raum von unendlicher Größe geworden, wie die TARDIS bei Dr. Who. Dieser Raum würde nicht mehr nur sonntags und an Weihnachten benutzt werden. Ich musste in der Nähe dieses Apparats bleiben.
Sonntagabende endeten unweigerlich mit Dads Aufforderung: „Mach dich fertig, Junge, morgen ist Schule. Ab ins Bad.“
„Alles klar, Dad, mach ich“, antwortete ich dann. Doch anstatt gleich für die obligatorische Körperpflege nach oben zu gehen, schlüpfte ich in die Stube und schaltete im Dunkeln das Radio ein. Das Licht, das es abstrahlte war zu schwach, um mich zu verraten. „Wo ist jetzt dieses Radio Luxemburg auf der Skala?“, fragte ich mich, als die Röhren warmliefen.
8: Meine Mondlandung
Als ich elf war, absolvierte ich das vorgeschriebene Elf-Plus-Examen, das darüber entschied, ob ich auf ein Gymnasium oder eine Mittelschule gehen würde. Traditionell war das Gymnasium angesagt. Mein Vater ließ mich in einem Anfall pädagogischer Einsicht eine spezielle Prüfung für Birminghams bestes Gymnasium, die King Edwards Grammar School, ablegen (dort hatten sie J. R. R. Tolkien unterrichtet). Aber ich fiel durch, nachdem ich mich zwischen den Tests beim Herumtollen auf dem Sportplatz völlig mit Matsch beschmiert hatte. Mein Dad bekam einen solchen Wutanfall, dass ich mich in der zweiten Runde nicht mehr davon erholte und mit den Aufgaben nichts anfangen konnte.
Ich mochte nicht der fleißigste Schüler gewesen sein, doch ich bestand das reguläre Elf-Plus-Examen und verließ die beschränkte katholische Welt von Our Lady of the Wayside in Richtung der grüneren Gefilde der County High School in Redditch. Die Schule war eine sechzigminütige Busreise von unserem Haus in Hollywood entfernt. Ich gewöhnte mich dort nie recht ein. Auch dort war das System sehr konkurrenzbetont, und die Klassen waren größer. Es war mir unmöglich, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich gebraucht oder mir gewünscht hätte. Nach ein paar mit fragwürdigem Erfolg absolvierten Jahren („Schlechteste zweite Klasse aller Zeiten: 2F3“; „Schlechteste dritte Klasse in der Geschichte der Schule: 3F2“) begann ich blauzumachen.
Zuerst schwänzte ich Sport, dann auch den Unterricht im Anschluss daran. Mit der Zeit fiel es mir immer schwerer, Interesse für das schulische Angebot aufzubringen. Ich war kein Star auf dem Sportplatz, schaffte die Arbeit nicht, ich war nicht im Orchester, und in der Klasse hatte ich keinen Anschluss. Meistens beschäftigte ich mich obsessiv mit Julie McCoy, mit der ich jeden Abend mindestens eine Stunde telefonierte. Die Tatsache, dass sie einen Freund hatte, hielt mich nicht davon ab, aber sie sorgte dafür, dass nicht mehr daraus wurde.
Die Schule gab mich schließlich auf. Ich hielt mich für sehr clever, dass ich damit durchkam, aber die Lehrer dachten wohl einfach: „Warum sollen wir uns mit ihm abmühen, wenn wir all die anderen Kinder haben, die das wollen, was wir ihnen anbieten?“
Meine Eltern hatten keine Ahnung, was vor sich ging. Sie kümmerten sich noch weniger um meine Schulausbildung als ich. Wenn die Schule ihnen einen Brief schrieb, um mich zu verpfeifen, konnte ich das förmlich riechen, und er kam nie an. Ich wurde ein versierter Fälscher. Ich konnte die Unterschriften meiner beiden Eltern perfekt imitieren, und es war leicht, ein „E“ auf dem Zeugnis in ein „B+“ zu verwandeln, was eigenartig war, wenn man den dazugehörigen Kommentar berücksichtigte: „Er hatte ein sehr schwaches Jahr, seine Leistungen sind weiterhin enttäuschend, B+.“
Während die Bedeutung der Schule abnahm, wurde die Musik zu einem immer größeren Einfluss in meinem Leben.
Als ich zwölf war, übernahm mein fünf Jahre älterer Cousin Eddie, der im Viertel der Zeitungsjunge war, von meinem Vater die Rolle als wichtigstes männliches Vorbild. Ich war, ganz so wie es in all den Büchern über die Erziehung von Jungen steht, auf Zielkurs.